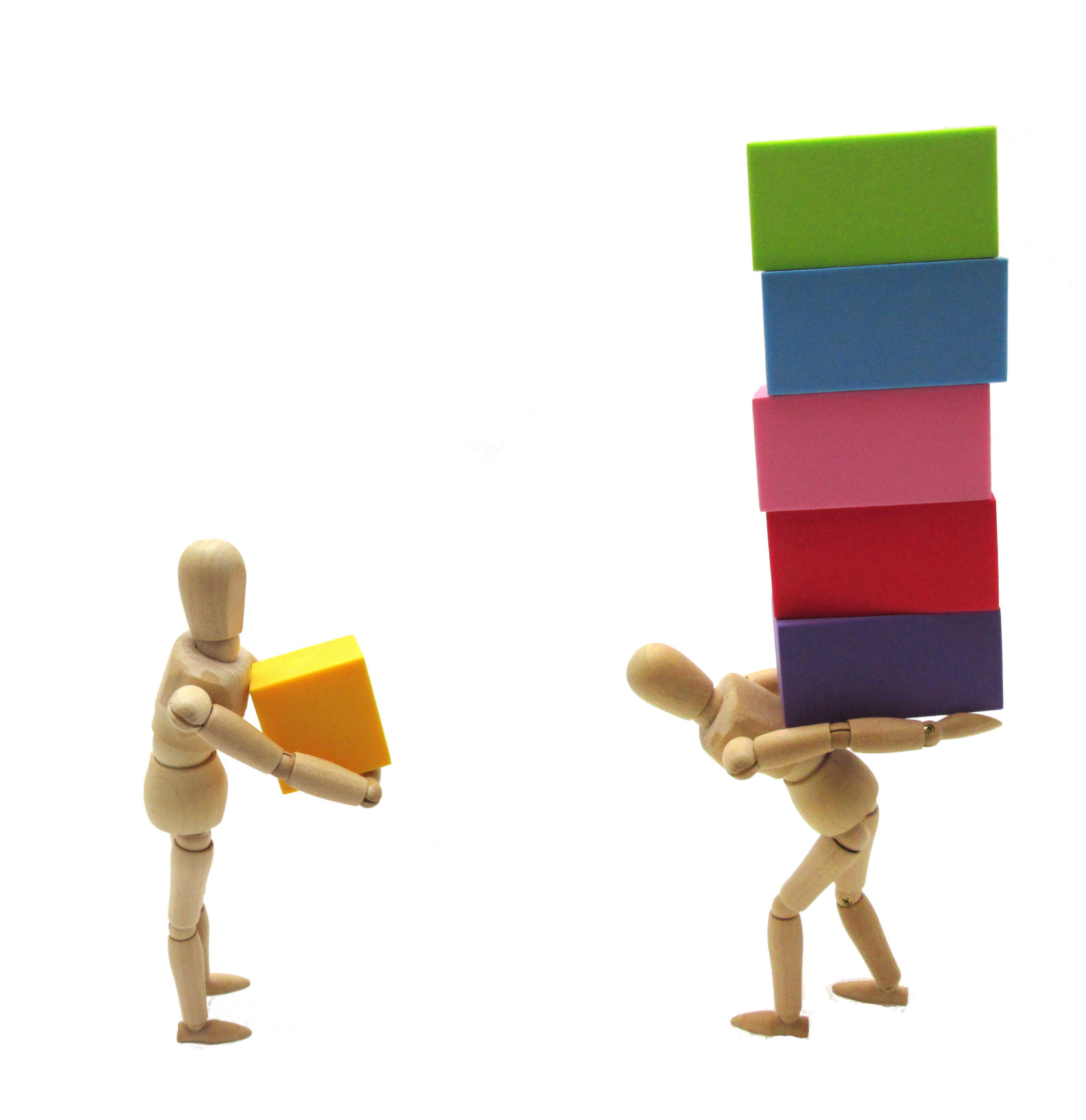Das Prinzip „ein Mensch, eine Stimme“ (one man, one vote) gilt als wesentliches Prinzip der Demokratie. Dieses Prinzip soll garantieren, dass die Interessen aller Mitglieder der Gesellschaft in gleichem Masse berücksichtigt werden und die getroffenen Entscheidungen von den Bürgern mitgetragen dadurch legitim sind. Eine wiederkehrende Kritik an der Demokratie besteht jedoch darin, dass sie zu einer „Tyrannei der Mehrheit“ führen kann: wenn alle Bürgerinnen eine gleich stark gewichtete Stimme in demokratischen Entscheidungsverfahren haben, besteht das Risiko, dass eine Mehrheit Entscheidungen trifft, die Minderheiteninteressen permanent verletzen.
Heisst das, dass wir dieses Prinzip verändern, und die Stimmen der einzelnen Bürger unterschiedlich gewichten sollten? Dies ist die Meinung des im 19. Jahrhundert wirkenden englischen Philosophen John S. Mill. Er meinte, dass die Mehrheit der ‚ungebildeten Arbeiter’ nur an ihre persönlichen Interessen denken würde. Diese Mehrheit würde in einer Art entscheiden, die nicht nur im Widerspruch zu den Interessen anderer sozialer Klassen, sondern auch im Widerspruch zum Gemeinwohl stehen würde. Deshalb sollten die gebildeten, besser qualifizierten (männlichen) Bürger mehr Stimmgewicht bekommen. Nur so könnten laut Mill moralisch wünschenswerte Entscheidungen auf demokratischem Weg getroffen werden.
Dieser Vorschlag wirft aber mehrere Probleme auf, deren drei ich nennen möchte. Erstens wissen wir gar nicht, ob die Gebildeten die Interessen der Ungebildeten wirklich verstehen und repräsentieren können, und noch weniger, ob sie dies dann auch tatsächlich tun würden. Ihre Qualifikation berechtigt sie nicht per se dazu, dass sie für die Arbeiter entscheiden und diese dadurch ihrer Autonomie berauben. Zweitens impliziert die Stimmverteilung nach Bildungsniveau, dass die Bürgerinnen hierarchisiert werden. Demokratie verlangt aber, dass allen der gleiche Respekt entgegengebracht werden muss – eine Norm, die missachtet wird, wenn der Staat bestimmt, wer ein mehr und wer ein weniger kompetenter Bürger ist. Drittens kann der Staat sich auf keine zuverlässigen, nichtwillkürlichen Kriterien stützen, um diese Hierarchie festzulegen. Wie kann man bestimmen, wer gebildet oder kompetent genug ist oder nicht? Statt wünschenswerter Entscheidungen würde Mill’s Version der unterschiedlichen Stimmgewichte wohl ein starkes Gefühl von Ungerechtigkeit mit sich bringen.
Es gibt aber andere und zeitgemässere Vorschläge, um unterschiedliche Stimmgewichte zu institutionalisieren. Beispielsweise schlagen die Philosophie- und Sozialwissenschaftsprofessoren Harry Brighouse und Marc Fleurbaey folgendes Prinzip für die Verteilung von Stimmgewichten vor: das Verhältnismässigkeitsprinzip. Da nicht alle in gleichem Masse von bestimmten politischen Entscheidungen betroffen sind, ist das „ein Mensch, eine Stimme“-Prinzip nicht gerecht. Nicht betroffenen Bürgern genau so viel Einfluss zu geben, wie Bürgerinnen, die stark betroffen (und möglicherweise Teil einer Minderheit) sind, bedeutet, dass eine Entscheidung von Personen getroffen wird, welche die Folgen ihrer Entscheidung nicht tragen müssen. Um dieses Problem zu überwinden sollten deshalb unterschiedliche Stimmgewichte verteilt werden, so dass jeder Bürger eine Stimme proportional zu seiner Betroffenheit bekommt. Das Prinzip lautet also, dass diejenigen Leute, die von einer politischen Entscheidung stärker betroffen sind als andere, mehr Macht in einem Entscheidungsverfahren bekommen sollten.
Im Gegensatz zu Mill’s Vorschlag, würde das Verhältnismässigkeitsprinzip die Autonomie aller Bürgerinnen schützen. Die am stärksten betroffenen Mitglieder der Gesellschaft hätten eine bessere Chance, ihre Interessen zu verteidigen und selbst zu bestimmen. Zudem würde auch die Norm des gleichen Respekts für alle verwirklicht: um das Verhältnismässigkeitsprinzip zu realisieren ist es nicht nötig, die Kompetenzen der Bürger zu beurteilen. Statt eine Hierarchie einzuführen, ermöglicht dieses Prinzip, die Interessen aller gemäss ihrer Betroffenheit durch eine Entscheidung zu berücksichtigen, und dadurch Respekt für alle auszudrücken. Somit würde dieses Prinzip kein Gefühl von Ungerechtigkeit vermitteln. In der politischen Praxis richtet man sich bereits oftmals nach der Idee, dass einige Entscheidungen von denjenigen getroffen werden müssen, die stärker betroffen sind: lokalpolitische Entscheide sind ein sehr gutes Beispiel dafür.
Wäre es also aus demokratischer Sicht besser, wenn nicht jede Stimme gleich viel zählte, und das Stimmengewicht gemäss der individuellen Betroffenheit festgelegt würde?
Selbst wenn das Verhältnismässigkeitsprinzip ziemlich überzeugend ist, gibt es Anlass zu Einwänden. Wie entscheiden wir beispielsweise, wer betroffen ist? Ist es überhaupt möglich, vor der Abstimmung den Grad der Betroffenheit jeder Bürgerin und jeder Bürgergruppe festzustellen? Die Betroffenheit verschiedener Gesellschaftsmitglieder scheint stark davon abzuhängen, was genau entschieden wird. Sollten wir also allen möglicherweise von einer Entscheidung Betroffenen mehr Stimmengewicht zugestehen? Aber wie könnten wir dann unterschiedliche Grade der Betroffenheit bestimmen? Ohne klare Antworten auf diese Fragen scheint es vermessen zu behaupten, dass eine ungleiche Stimmenverteilung kein Gefühl von Ungerechtigkeit erzeugen würde.
Eine andere Frage ist, ob Minderheiten vor einer Tyrannei der Mehrheit durch diese Massnahme wirklich geschützt werden würden? Einerseits können stark betroffene Minderheiten ihre Interessen unterschiedlich definieren. Es wäre also möglich, dass eine Minderheit, die genug Einfluss im Entscheidungsverfahren gewonnen hätte, zu einer Entscheidung kommen würde, die ihre ‚korrekten’ (langfristigen) Interessen nicht verteidigen würde; was könnten wir in einem solchen Fall tun? Andererseits kann es sein, dass verschiedene stark betroffene Minderheiten unterschiedliche Interessen haben. Wer sollte dann ‚gewinnen’? Und sollten wir eine Entscheidung als legitim erachten, welche die eine Minderheit verteidigt aber eine andere benachteiligt? Es sieht so aus, als ob es keine Garantie gibt, dass (alle) Minderheitsinteressen mit diesem Stimmsystem immer verteidigt werden können.
Eine ungleiche Gewichtung von politischen Stimmen kann also nicht die beste Lösung sein, um die Rechte und Interessen von Minderheiten zu schützen. Konstitutionelle Rechte bilden wahrscheinlich eine angemessenere Garantie, um eine Tyrannei der Mehrheit zu vermeiden. Das heisst aber nicht, dass der Vorschlag, den stark Betroffenen mehr Macht in Entscheidungsprozessen zu geben, ganz zurückgewiesen werden muss. Er bietet Minderheiten eine Chance, ihre Perspektiven und Interessen vor der Entscheidung hervorzuheben – und nicht erst nach dem Verfahren, wie dies durch die Grundrechte geschieht. Auch wenn das Prinzip „ein Mensch, eine Stimme“ – strikte Gleichheit – heutzutage die beste Alternative für demokratische Entscheidungsprozesse darstellt, und den Grundsatz des gleichen Respekts für alle sowie das Vermindern der Ungerechtigkeitsempfindung umsetzt, ist es keine perfekte Lösung. Dieses Prinzip kritisch in Frage zu stellen ermöglicht es, zu sehen, wo ihre Beschränkungen liegen. Das Konzept von gleichem Respekt, das es repräsentiert, scheint nicht genügend in Betracht zu ziehen, dass einige stärker betroffen sind als andere. Es scheint also noch Gelegenheit zu geben, darüber nachzudenken, wie wir unsere demokratischen Entscheidungsverfahren verbessern können.
Literatur
Arneson, Richard J. (2003): Democratic Rights at the National Level. In: Christiano, Thomas, Philosophy and Democracy: An Anthology. Oxford: Oxford University Press, 95-115.
Brighouse, Harry and Fleurbaey, Marc (2010): Democracy and Proportionality. Journal of Political Philosophy 18(2), 137-155.