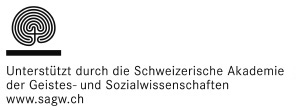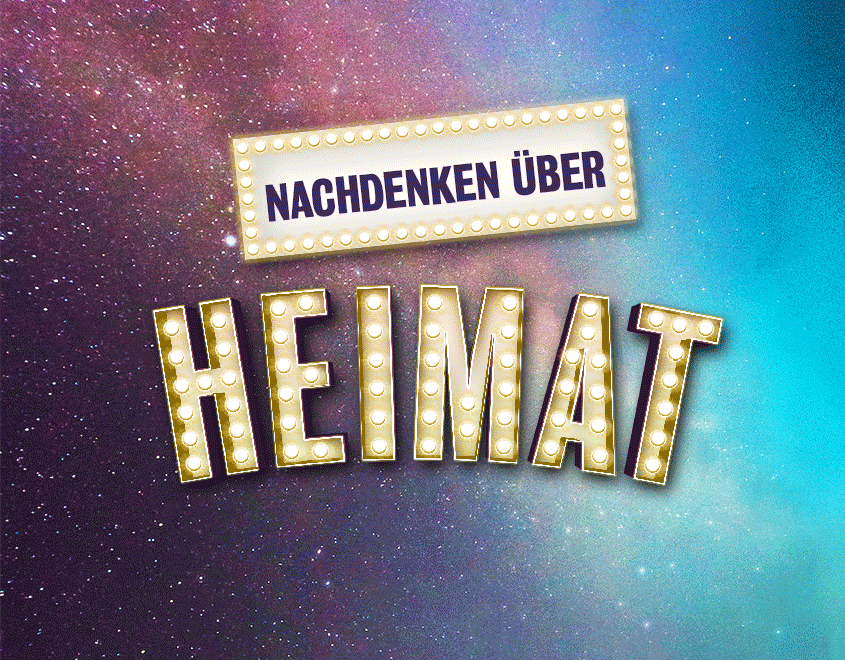Heimat ist ein vermintes Gelände, ein kontaminiertes Feld – in ihrem Namen wurde diskriminiert und gemordet, geschützt und gerettet. Es gebe kaum ein Wort, so Margarete Hannsmann in ihrem Bekenntnis Heimatweh, „das mich zerreißt wie dieses“ – unfassbar unbestimmt im Niemandsland zwischen „schierer Angst“ und „reinstem Glückszustand“. „Schiere Angst“ vor bornierter Enge, kleinkarierter Gartenzwergkultur und provinzieller Selbstgenügsamkeit. Einerseits, andererseits aber eben auch: „reinster Glückszustand“, weil kein anderes Wort ihre Gefühle von Geborgenheit, von Aufgehobensein – die Erfahrung einer Übereinstimmung von Innen und Außen, besser benennen könne als eben diese scheinbar schlichte Vokabel Heimat. In der Gebrauchsgeschichte des Begriffes kippte das Versprechen, das Eigene und Vertraute bewahren zu wollen, regelmäßig in militant-xenophobe Wendungen gegen Fremdes. Heimat fungierte alsbald als ideologisch aufgeladene Abwehr- und Abschottungsformel, sodass sich durch und durch Widersprüchliches – Regression und Utopie, Glück und Verbrechen, Humanisierung und Barbarei – an dieses eigentümliche Wort lagert. Immerzu mobilisierten Imaginationen des Heimatlichen als Kehr- und Nachtseite die Bereitschaft zu rücksichtlosem Exzess – das Unheimliche als verdrängter Anteil des Heimisch-Vertrauten, wie Sigmund Freud schon 1919 in Das Unheimliche die andere Seite hervorkehrte. Nur vordergründig Nicht-Zusammengehörendes kennzeichnet die beiden Seiten der Heimat-Geschichte.
Auch heute, in unruhigen Zeiten beschleunigten Wandels, Globalisierung und Migration, ist viel von Heimat die Rede. Ist der Begriff vonnöten oder verzichtbar? Vielleicht schon eine falsche Frage: Wenn er immer wieder mit unterschiedlicher Intonation und Akzentuierung aufgerufen wird, dann sind ihm offenkundig bestimmte Erfahrungen und Bedürfnisse eingeschrieben, die nicht einfach sprach- und gesinnungspolizeilich zensiert werden können. Die Berufung auf Heimat kann nicht einfach abgesprochen werden, genauso wenig wie jemand Liebe abgesprochen werden kann, auch wenn sie noch so auf Selbsttäuschung basieren mag. Vielleicht schon eine erste wichtige Beobachtung: Das Reden über Heimat hört nicht auf, sondern erfährt im Rhythmus bestimmter Krisen immer wieder Konjunktur. Dieses zweisilbige Wörtchen hat etwas von einem hartnäckigen Wiedergänger, der sich zumindest nicht ordentlich begraben lässt, sondern in regelmäßigen Zyklen immer wieder Krisensymptomatik und Klärungsbedarf signalisiert. Wäre zu klären: Liegt dies daran, dass das „Chamäleon Heimat“ (Hermann Bausinger) etwas benennt, das ohne dieses Wort nicht sagbar wäre? Transportiert der Begriff Sehnsüchte, die ohne ihn nicht auskommen? Oder umgekehrt: Besitzt er gerade deshalb Anziehungs- und Verführungskraft, weil er so schön vernebelt, so kaugummiartig als Platzhalter oder „Plombe“ (Paul Parin) in jede Lücke passt?
Jedenfalls - die Verwendungsweisen irritieren:
- Unisono bewerben in Lebensmittel-Discountern Slogans wie Heimat ist Ursprung oder Unsere Heimat zusammen mit Hübsch-Bildern aus idyllischen Landlust-Welten fragwürdig billige Lebensmittel, die eben garantiert nicht aus sozial und ökologisch intakten Umwelten, sondern aus denaturierten Agrarfabriken stammen. Offenbar benötigt es solch mentaler Geschmacksverstärker wie Heimat, dass diese Produkte als Nahrung überhaupt identifiziert werden können – Heimat als mentaler Ersatz, als Selbsttäuschung.
- Unsere Heimat bleibt deutsch – heißt es entschieden auf den Transparenten deutscher Rechtspopulisten. Gemeint sind die Kampfparolen weniger als ein selbstgewisses Bekenntnis zum Eigenen, sondern vor allem als Abwehr und Abwertung der Anderen. Hier wird im Namen der Heimat militante Ausgrenzung vollzogen und ein Kult des Eigenen, des Art-Eigenen betrieben. Thüringer Heimatschutzes nannte sich der Vorläufer des Nationalsozialistischen Untergrunds und verstand dies als Legitimation für seine Mord- und Terrorserie gegen alles Nicht-Deutsche. Heimatschutz war um 1900 eine bildungsbürgerliche Bewegung, die die Kehrseite des Fortschritts, die Destruktionsmöglichkeiten moderner Industriezivilisationen und damit auch die Frage nach der Natur, aber auch nach Tradition stellte. Da war zunächst ein Gestus der Fürsorge, bewahrende Zuwendung, Eigenart erschien bereichernd...
- Heimat präsentiert sich als Spielart des Kitsches und Kommerzes seit der Industrialisierung in allerlei lieblichenVarianten: Heimatroman, Heimatfilm, Schlager, Verdirndelung, folkloristische Kulissenheimaten und künstliche Idyllen des Tourismus und der Heile-Welt-Aquarellisten.
- Heimat ist da, wo ich keine Scheiße an der Backe habe, meinte einmal zweifelsfrei eine Studentin in der ersten Sitzung eines Heimat-Seminars. Nach höflichem Insistieren auf weniger Anschaulichkeit, sprach sie von ihrer Sehnsucht nach einer Welt, in der nicht alles kompliziert und undurchschaubar scheint, und von einem sozialen Raum, in dem sie sich nicht verstellen und verbiegen müsse, sondern „einfach so“ angenommen werde.
- Making Heimat – Germany, Arrival Country. So lautete 2016 der deutsche Beitrag zur internationalen Architekturausstellung in Venedig. Dabei geht es um die brisante Frage, wie den Heimatlosen unserer Zeit, den Hunderttausenden von Flüchtlingen, nicht nur ein funktionelles Dach über dem Kopf, sondern auch Räume gegeben werden können, die in der Unwirtlichkeit unfreiwilliger Fremde tatsächlich ein Zuhause sein könnten. Auch wenn an Heimat gelagertes Denken und Fühlen immer von Erfahrungen des Verlustes stimuliert werden und mit Intentionen der Kontingenzbewältigung einhergehen: Im Kontext von Flucht, Vertreibung und Migration drängt ihre Abwesenheit am schmerzlichsten und intensivsten zur Vergegenwärtigung von Heimat.
Das scheint bemerkenswert – dieses reibungslose Hinübergleiten, das Kippen von Fürsorge ins Gegenteil, dieses Changieren der Heimat-Künder zwischen Humanisierungsversprechen und entfesselter Brutalität. Entfremdung als Überfremdung. So erscheint Heimat irgendwo zwischen folkloristischer Gemütlichkeit und Barbarei, wahlweise als himmlische Heimat und damit als Vertröstung auf das Jenseits, Zutrauen schenkende Geburts- und Kindheitsheimat, Paradies, Spießeridylle, Kampfvokabel...
Alles wahllos? In jedem Fall meint Heimat immer „Bindung“ – ob an Orte, Worte, Menschen, ob an Herkunft, Natur oder ein geistiges Zuhause. Bindung schenkt Sicherheit, vermag freilich unmerklich zur Fessel werden. Da ist jenseits aller Vagheit und Unschärfe freilich auch eine anthropologische Dimension: Der Mensch ist von Natur aus heimatlos, zugleich nirgendwo und doch (fast) überall zuhause. Wir sind alle Migranten, verwaiste und bedürftige Fremdlinge auf Erden. Die Welt ist offen, aber abweisend. Der Mensch, von Natur aus in zwiespältiger, disharmonischer Beziehung zur Welt, benötigt eine Eigenwelt, in die er gehört, die ihm vertraut ist, sicher, verlässlich und stabil, mit der sich anfreunden lässt. Das Gattungswesen Mensch muss sich beheimaten. Beheimatung als eine Aufgabe tätiger Weltaneignung, durch die der Mensch – immer und überall – eine für ihn unwirtliche Welt erst in ein Zuhause verwandelt. Statt „Heimat“ also besser einfach „Zuhause“?
Heimat erschien immer als eine mögliche Antwort auf Krise, ein Krisensymptom. Dies setzt sich fort mit der Entfaltung moderner Industriezivilisationen bis hin zu unserer gegenwärtigen Epoche der Globalisierung, in der nun wieder so viel von Heimat die Rede ist. Wieder sind es ähnliche Erfahrungen, ähnliche Zumutungen, die dem Wortgeschöpf Resonanz und Plausibilität verleihen – Erfahrungen des Verlusts, des beschleunigten Wandels, fragwürdiger Zugehörigkeiten, Auseinandersetzungen mit Fremdem, eben Nicht-Vertrautem. Vielleicht lässt sich ja diese Rechnung aufmachen: Je komplexer die Wirklichkeit, je undurchschaubarer, desto drängender und lauter umgekehrt die Heimat-Reden. In jedem Fall: Dem Reden über Heimat geht immer erst ein Verlust voraus – eine Vertreibung aus irgendeiner Form von Paradies, auch wenn dieses nie ein Paradies gewesen sein mag.