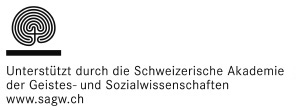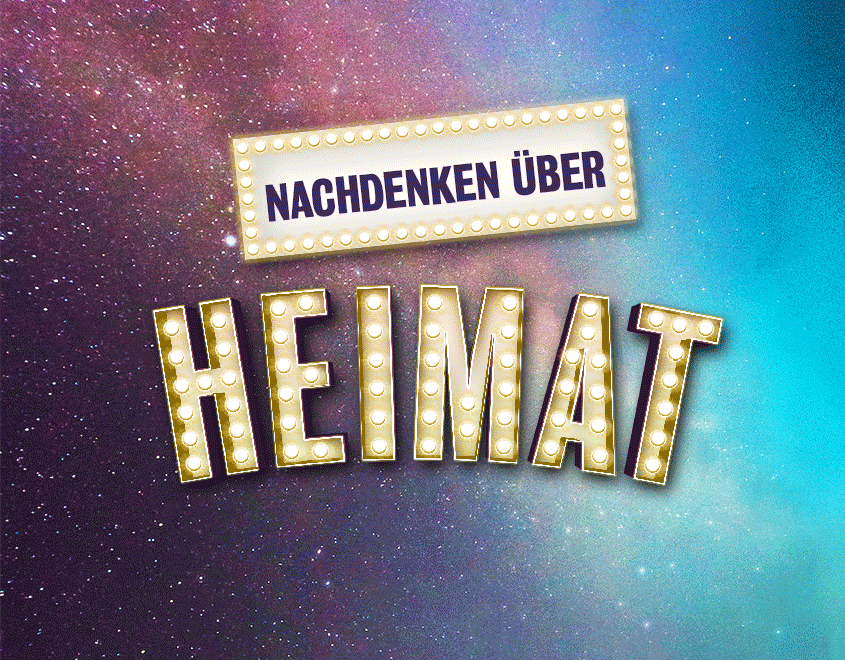Heimat: Ein sehr deutscher und ganz und gar unphilosophischer Begriff, spricht er doch direkt das Gemüt an (auch so ein Wort), und nicht den Verstand. Es gibt also viele Gründe, dem Begriff nicht nur philosophisch mit Skepsis zu begegnen. Und dennoch, es gibt einen Philosophen, der einem sofort in den Sinn kommt, wenn es um Heimat geht, auch und vielleicht gerade dann, wenn man ihn gar nicht intensiv studiert hat. Zumindest das Ende seines berühmtesten Werkes kennt man als Philosophiestudentin irgendwann, und wenn es eine Bedeutung des Begriffs „Heimat“ gibt, die es sich zu vergegenwärtigen lohnt, dann ist es diese:
– vis à vis de tout. Mit diesem Blick also gilt: Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte, ja alles und jedes steht noch vor Erschaffung der Welt, als einer rechten. Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende, und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heißt sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfaßt und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat.[1]
In der kleinen Stadt im Südwesten Deutschlands, die irgendwann zu meiner Wahlheimat geworden ist, habe ich viele Jahre am Fuss des Hügels gewohnt, auf dem dieser Philosoph im August 1977 beerdigt worden ist, begleitet von einem Fackelzug von über dreitausend Studenten. Der Friedhof befindet sich am südlichen Rand der Stadt, auf dem Galgenberg, und das Grab des Philosophen liegt ganz unscheinbar neben einer Kapelle, mittlerweile verwittert und mit einer Inschrift, die man nicht mehr allzu gut lesen kann. Anders als die vielen anderen berühmten Gelehrten, mit deren Namen die Stadt verbunden ist, hat er keinen Ehrenplatz auf dem zentralen Stadtfriedhof erhalten.
Im Herbst desselben Jahres, nur zwei Monate später, obduziert auf diesem Bergfriedhof ein bekannter Gerichtsmediziner und ehemaliger SS-Mann die Leichen dreier Terroristen (zweier junger Männer und einer jungen Frau, die auch einmal eine Studentin an der dortigen Universität und dann Verlegerin gewesen ist) und nimmt ihnen anschliessend heimlich Totenmasken ab, die er als „Trophäen für den Panzerschrank“ aufbewahrt.[2]
Heimat, auch und gerade als etwas, das eine Bedeutung für die Zukunft haben soll und erst entsteht, gibt es nicht ohne Vorgeschichte und ohne die Geschichten konkreter Menschen, die in einem bestimmten historischen Moment an einem bestimmten Ort gelebt und gehandelt haben. Vis à vis de tout, mit diesem Blick sieht man dann nicht nur die Dichter und Denker, sondern auch die Richter und Henker, die einen Ort und eine Zeit geprägt haben, zuweilen auch beides auf einmal.
Als ich Mitte der Nullerjahre in jener Stadt ankam, war unter der ersten Post in meinem Briefkasten eine Einladung der Fachschaft Philosophie und auf dem Schreiben befand sich ein Logo, eine geballte Faust und darum angeordnet der Schriftzug: Ernst Bloch Universität Tübingen. Es dauerte eine Weile bis ich verstand, warum die Universität, an der ich studieren würde, plötzlich anders hiess als in den bisherigen Schreiben, warum sie offenbar zwei Namen hatte. Es gab den offiziellen Namen, der – bis heute – auf zwei fragwürdige historische Figuren verweist, nämlich auf Graf Eberhard im Bart, den Universitätsgründer von 1477, der im selben Jahr die Juden aus der Stadt hat vertreiben lassen, und auf Herzog Karl Eugen, einen absolutistischen Herrscher des 18. Jahrhunderts, der unter anderem für Schillers Flucht aus Stuttgart verantwortlich gewesen ist. Den anderen Namen gibt es auch noch, seit knapp vierzig Jahren artikuliert sich darin ein basisdemokratischer gesellschaftspolitischer Gegenentwurf zum Zeitgeist, der sich auf das konkrete Wirken Ernst Blochs nicht nur in Tübingen beruft.
Wenn es immer mehr als eine Geschichte, mehr als eine Bedeutung eines Ortes und eines historischen Faktums gibt, dann bleibt es eine gemeinsame Aufgabe, Heimat im Plural zu schaffen, Heimat als etwas, worin alle sein können, so verschieden sie auch sein mögen. Dass Heimat nicht etwas ist, zu dem man ein für alle Mal gehört oder das einem angehört, sondern ein Ort, der mehr in der Zukunft als in der Vergangenheit liegt, eine konkrete Utopie, die in dieser Welt und für alle realisierbar sein muss, das ist ein Gedanke, der aktuell so wichtig ist wie zu jener Zeit, in der Ernst Bloch in Tübingen seine Vorlesungen hielt. Auf seinem Grabstein, oben auf dem Tübinger Bergfriedhof, steht der schönste und versöhnlichste Satz, den man sich für diesen Ort vorstellen kann: „Denken heisst Überschreiten.“[3]
[1] Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt a.M. 1959, S. 1628.
[2] Vgl. Jürgen Dahlkamp: Trophäen für den Panzerschrank, in: Der Spiegel 42/2002 (14.10.2002). http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-25448057.html, Letzter Zugriff: 9.2.2017.
[3] Der Satz stammt aus dem Vorwort zu Das Prinzip Hoffnung, das zwischen 1938 und 1947 im amerikanischen Exil entstanden ist, und es geht dort folgendermassen weiter: „Freilich, das Überschreiten fand bisher nicht allzu scharf sein Denken. Oder wenn es gefunden war, so waren zu viel schlechte Augen da, die die Sache nicht sahen. Fauler Ersatz, gängig-kopierende Stellvertretung, die Schweinsblase eines reaktionären, aber auch schematisierenden Zeitgeistes, sie verdrängten das Entdeckte.“ Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung, S. 3f.