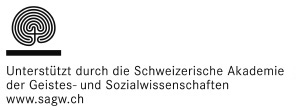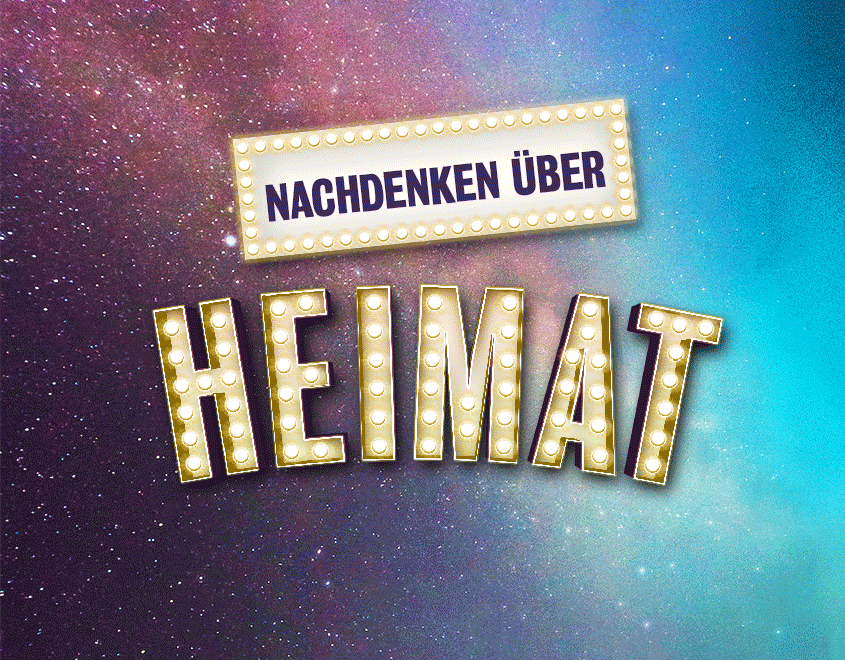i
„Heimweh nach Heimat, wo das auch sein mag“, schrieb Bettina Wegner vor vielen Jahren in einer Liedzeile. Evoziert ist damit ein Heimatbegriff, der nahe dem utopischen Schwebezustand ist, wie ihn Ernst Bloch am Ende seines Hauptwerks ‚Das Prinzip Hoffnung‘ benennt und wie er zu den am meisten zitierten Topoi des Heimatdiskurses gehört: Es scheint allen in der Kindheit voraus - und doch war noch niemand darin. Man kann erwarten, sich diesem Ort zu nähern, nicht aber, darin anzukommen. Bloch verbindet dies mit dem Entwurf eines befreit unentfremdeten Lebens, einer Demokratie, die nach Jacques Derrida auch „ein avenir“ ist – im Ankommen, aber an keinem Ort, nirgends situierbar.
Judentum und Christentum benennen ebenso wie der Platonismus Heimat mit guten Gründen als transzendenten Ort: Erst im Licht des Messias ist sie möglich, oder, wie es die Johannesoffenbarung sagt, im himmlischen, jenseitigen Jerusalem nach dem Ende dieser Welt und Zeit, wo Leid, Schmerz und Geschrei aufhören werden. Platon spricht vom Ort „jenseits des Seins“, an dem die Idee des Guten zu suchen ist.
Heimat, das Eigene, gewinnt man vielleicht erst aus dem Anderen, im transversalen Blick. Erst von der Übersetzung her wird man sich dann der Konturen des Eigenen inne. Hölderlin hat in seinen späten Hymnen eindrücklich von dieser Rückkehr ins Eigene gesprochen, die am schwersten sei. Die deutsche Germanistik hat daraus eine „vaterländische Wendung“ konstatiert, mit allen ideologischen Kodierungen. Doch die Bewegungsstruktur, dass das Eigene zuerst, oft nach langen Verwerfungen im und aus dem Anderen, Gestalt gewinnt und dass die Aneignung und Verwurzelung in diesem Eigenen der schwierigste Vorgang ist, bezeichnet eine dauerhafte Wahrheit.
Zur Hypostase, zum fixierten Besitz jedenfalls eignet sich Heimat nicht. Sie ist, im Sinn einer anthropologischen Grundspannung, auf die Helmuth Plessner hinwies, selbst ortlos und orthaft in einem. Sie kann zum Fluchtpunkt dieser inkommensurablen Sehnsucht werden, kann aber auch der Ort sein, von dem man fliehen möchte und dem man doch nie entgeht. Es gibt eine negative Heimatliteratur der Moderne, zwischen Arnold Stadler und Josef Winkler, die dies beständig evoziert.
Ablesbar ist die Grundstruktur dem „Weltbeispiel Mensch“ (Rudolph Berlinger). Genauer, dem Verhältnis zum eigenen Leib. Einen Körper haben wir nur, unser Leib sind wir. Er ist, wie Nietzsche meinte, Leitfaden des Denkens, auch dessen Begrenzung. Doch er ist gerade nicht das Transparenteste, offen zutage Liegende. Wie unzugänglich er ist, wird an Störungen und Krankheiten offensichtlich. Mithin ist er opak, entzogen. Er kann zum Selbstgefühl widerständig werden, oder zum wohnlichen Lebenshaus. Das sind Metaphern und Metonymien, die Wesensbestimmungen von Heimat einkreisen.
ii
In einem Zeitalter umfassender struktureller Gewalt ist Heimat, gemäß dieser menschlichen Konstanten, die sich in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich manifestieren mögen, auch essentiell ein Rechtsbegriff, der mit der menschlichen Würde und ihrer Realisierung eng verbunden ist. Ethnische Säuberungen, Vertreibungen, erpresste Verluste von Heimat bedeuten heute ein Politikum ersten Ranges. Sie sind Negationen dieses menschlichen Grundanspruchs.
Erinnert ist damit an den alten Antaios-Mythos, dem zufolge die Verwurzelung erst die Kraft gibt. Das versprochene Land, in das Gott sein Volk führen will, ist die Entsprechung dazu im Sinai-Bund. Sie geht über den Antaios-Mythos hinaus, weil auch ein kodifiziertes Recht und die zweite Natur, die kulturelle Prägung, in den Rechtstitel des verheißenen Landes gehören. Eine Heimat, die nicht nur chthonische und familiäre Zugehörigkeit benennt, sondern zugleich angeeignete Überlieferung, sich Wiederfinden in einem bestimmten Symbolisationssystem wäre über sich selbst aufgeklärt und erlaubte auch reflexive Distanz zur gegebenen Heimat einzunehmen.
Im Einzelnen ist es für die politische und rechtliche Verfassung des Menschen offensichtlich ein Grundrecht, diesen Ort bewohnen zu können. Er kann dann Anlass zu Ausgriffen ins Weite und auch zu Abwendungen werden. Doch es gehört rechtsphilosophisch in die Eigentumssphäre einer dem Menschen zugeordneten Welt, die für realisierte Freiheit unerlässlich ist: Eine Möglichkeit, die man ausschlagen kann, die man aber zunächst einmal wahrnehmen können muss. Vielleicht ist Heimat in diesem Sinn anthropologisch und rechtlich die erste Voraussetzung jener ‚Natalität‘,
Die Migrationsströme und Fluchtbewegungen, die die Agenda dieser Jahre so stark beeinflussen, zeigen, welcher Hebel in der Heimatverweigerung liegt. Unworte, die das Humanum leugnen, wie „ethnische Säuberungen“ und „Zwangsumsiedlungen“ verweisen darauf, dass die Menschenwürde nicht im allgemeinen und abstrakt, sondern in concreto, in Raum und Zeit, wahrnehmbar sein muss. Der Rechtsgrund für mögliche „Heimat“ ist gleichsam der Schlüssel in diese Zusammenhänge. Nur von diesem Kernort, oder je nachdem, diesen Kernorten her kann Weltbürgerlichkeit in Anspruch genommen werden. Dass die Negierung dieses Rechts wesentliche Implikation eines ins Gigantischen gesteigerten Nationalismus und zugleich der rechtsfreien Räume in einer weltweiten Anarchie ist, macht die Verweigerung von Heimat zum Symbol der Nachtseiten einer planerischen Moderne.
iii
Auch aus der Not können Surrogatformen entstehen, Heimaten, aus denen man nicht vertrieben werden kann. In Jahrhunderten, Die Kindheit, formulierte Jean Paul einmal, ist das einzige Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann. Heinrich Heine sprach, mit der Erfahrung der Emigration im Rücken, von der Sprache als dem ‚Portativen Vaterland‘. Dem verdanken sich seine frei fliegenden, über-nationalen und zugleich tief in der deutschsprachigen Literatur ankernden Gedichte.
Der Heimat kann man sich verweigern. Es gibt die Bewegung, auch in Figurationen scheiternder Liebe, dass man dort nicht ankommen will, wo man in eigentlichem, tiefem Sinn zuhause sein könnte. Doch die Verweigerung ist wohl eine äußerste Form jener Freiheit, die es ohne Beheimatung kaum geben kann.