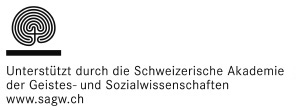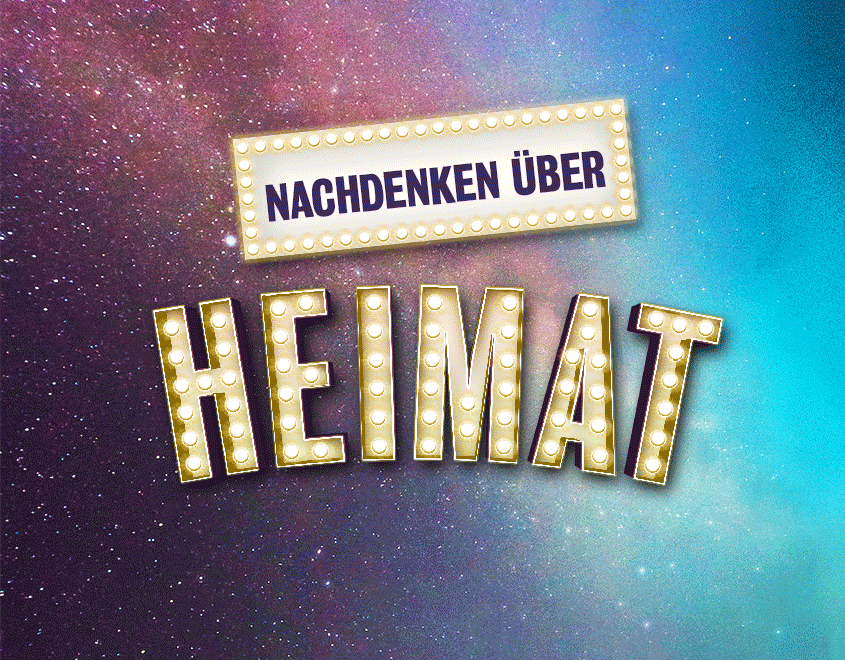Menschen fliehen aus ihrer Heimat, dem Ort, an dem sie sich geborgen fühlten, weil genau diese Geborgenheit verloren ist. Sie kommen zu uns, um Sicherheit zu finden, politische und religiöse Freiheit, Wohlstand, Gesundheit usw. Zugleich fühlen hiesige Menschen zu Recht oder Unrecht ihre Heimat-Geborgenheit bedroht durch Fremde. Andere Mitbürger wiederum wissen nicht mehr, was das denn sein soll – „Heimat“. Sie haben das intuitive Gespür dafür verloren oder sich verboten aus ideologischen oder psychologisch-unbewussten Gründen, damit das Fehlen der Bindung an Heimat als Ort, Landschaft, Sprachraum, Kultur, Religion oder bestimmte Menschen nicht schmerzt. Wenn ich keine Bindung an Heimat vollziehen konnte oder durfte als Kind, erlaube ich mir vielleicht auch später diese Beziehung nicht und lege mir eine Haltung von Heimat-Ignoranz bis hin zu Heimat-Verachtung zu. Suggeriert wird dann, Heimat-Bindung sei einer „Welt-Offenheit“ entgegen gesetzt. Aber so wie es keine Nächstenliebe ohne gesunde Selbstannahme gibt (alles andere wäre destruktiver Altruismus, der weder dem anderen noch mir nachhaltig hilft), so gibt es keine „Welt“-Liebe ohne Heimat-Liebe, beides braucht die wechselseitige Ergänzung.
Wenn die Welt „zu Gast bei Freunden“ ist (WM 2006), spüren Geflüchtete entweder eine Offenheit der Gastgeber, die ein gesundes Selbstbewusstsein ihrer kulturellen Eigenheit und Heimat-Verbundenheit haben, in der sie als Gastgeber Regeln für das Zusammenleben in ihrer Kultur-Heimat vorgeben. Oder sie spüren ein diesbezügliches Vakuum, das sie mit ihrer „inneren Heimat“ füllen werden. Denn jeder Mensch, der seine Ort-Heimat verlassen hat, bringt dennoch seine Sprach- und Kultur-Heimat mit sich: Von Essenskultur zu Bekleidungs-Gewohnheiten, von politischen Geschlechterverhältnissen zu religiös-geprägten Menschenbildern. Eine Bereicherung jenseits von Arbeits- und Konsumkraft findet in Essenskultur, Musik und Literatur, in Freundschaft unter Menschen usw. statt, solange ein gemeinsamer Nenner vorhanden ist oder vom Gastgeber hergestellt wird. Es geht nicht um Kultur-Hegemonie, sondern um die sachliche Gegebenheit, dass emotionale Zugänge zum neuen Kultur- und Sprachraum notwendig sind durch Erkundung der Kultur- und Naturlandschaft mit hiesigen Freunden, um „neue Heimat“ zu finden. Einen emotionalen Zugang zu „Werten unserer Demokratie“ erhalten Migranten z.B. durch das Narrativ des Nationalfeiertags, das von der ersten unblutigen Revolution Deutschlands handelt, einer Revolution, die aus der Kirche kam: „Mit Kerzen in den Händen kann man keine Steine werfen“. Nur wenn wir sowohl helle als auch dunkle Seiten (des Totalitarismus, der Ermordung von Juden u.a.) unserer Heimat anerkennen, gewinnen wir gesundes Heimat-Bewusstsein, das das Miteinander sucht.
Realer Verlust von irdischer Heimat – im Sinne von Lebensraum – als auch das Gefühl von Bedrohung der irdischen Heimat der Hiesigen lässt sich leichter bewältigen, wenn man in einer Beziehung zur ewigen Heimat lebt oder sie sucht. Alle Menschen sind nach christlicher Vorstellung „Fremde und Gäste auf Erden“, müssen daher verantwortungsvoll mit dieser Welt umgehen, zugleich wissend, dass sie nicht alles ist, dass „unsere Heimat“ vielmehr „im Himmel“ ist (Phil 3,19f.): die letzte Bindung, die niemals reißt, selbst wenn sämtliche Beziehungen im Irdischen auseinander brechen. Eine „Religio“, „Rückbindung an das Ewige“, ist dabei allerdings nicht schlechthin und ungeprüft hilfreich. Es kommt auf den Inhalt an, ob nämlich unter Religion eine christliche Konfession (kath., orth., ev., freikirchl.) oder die islamische Weltanschauung verstanden wird. Es macht für das anthropologische Selbstverständnis einen immens-unterschätzten Unterschied aus, welches Bild ich in mir trage von der „himmlischen Heimat“ und dem „Ewigen“, an das ich mich gebunden weiß.
Ist das Göttliche eine tyrannische Macht, die von mir Gehorsam unter Androhung von Gewalt verlangt, vor der ich mich als Unterworfene unter einen Herrscher verstehe, der sowohl barmherzig sein kann als auch bei Nicht-Gehorsam mit Strafen und Qualen droht. Oder ist das Göttliche wie ein barmherziger guter Vater, der sich nach verlorenen Söhnen (Töchter ab hier eingeschlossen) sehnt und ihre freie verantwortungsvolle Mitarbeit für eine Kultur des Lebens sucht. Das Selbstverständnis der Christen, von dem unsere kulturelle Heimat sowie wir Europäer auch noch als Agnostiker geprägt sind, ist laut Neuem Testament (in dessen Licht allein das Alte gelesen werden darf) eines von erwachsenen „Kindern Gottes“: Söhne des barmherzigen Vaters verstehen sich nicht als Knechte Gottes – das Bild, das muslimische Anthropologien wählen, der Mensch als Diener (keinesfalls Kind) Allahs (52,56) –, sondern als „Freunde“ (Joh 15,15) und sogar „Erben Gottes“ (Röm 8,17). Söhne und Erben des Hausherrn gehen mit Menschen und Gütern anders um als Diener, die Dienst nach Vorschrift tun und andere durch Einschüchterung an ihr Diener-Sein erinnern wollen. Der „freie Sohn“ kann den Vater ungestraft verlassen, sich angstfrei von Gott und der Kirche lösen, Atheist werden, während Diener immer entlaufene Diener sind, die Rache fürchten. Söhne Gottes (auch Ex-Söhne) sind freiwillig Diener an anderen in Caritas und Politik (= Minister). Ihre Werte von Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit (nur aufgrund eines gemeinsamen „Vaters“ möglich) basieren auf jahrhundertelang erprobter „Freiheit, zu der Christus befreit“ (Gal 5,1.13), nicht zu verwechseln mit Rücksichts- oder Lieblosigkeit. Unsere kulturell-politische religiös-geprägte Heimat hat Platz für Fremde, solange wir nicht unsere religiösen Wurzeln vergessen und ein Heimat-Vakuum kultivieren und solange wir zugleich die Grenze des Bezahl-, Organisier- und Integrierbaren im vernunftgeleiteten Blick halten.