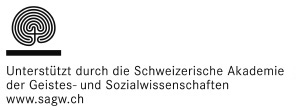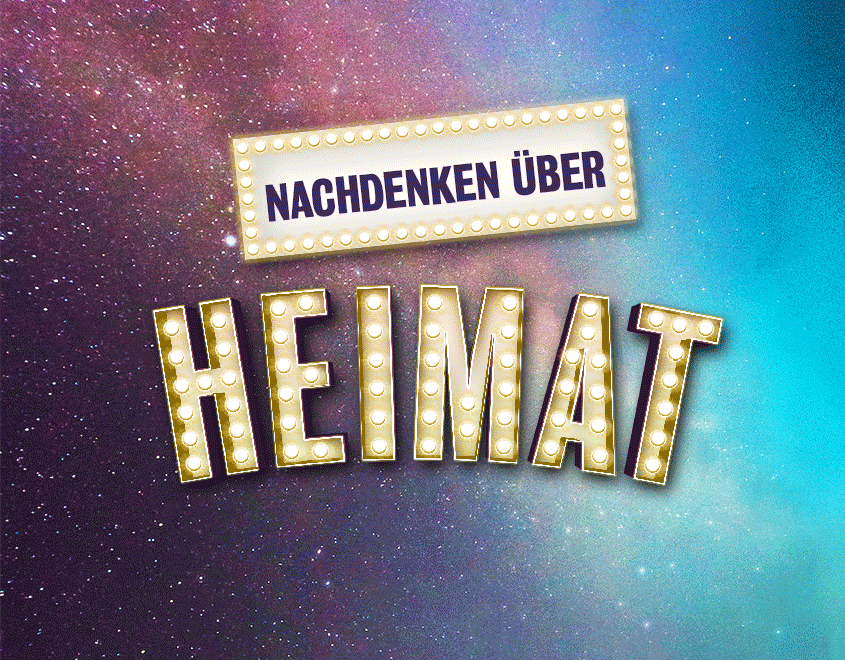Heimat ist jener Ort, der uns das Gefühl ursprünglicher und fragloser Vertrautheit vermittelt. Für viele Menschen ist das die Stätte ihrer Herkunft. Andere empfinden als Heimat jenen Ort, an dem sie besonders gute, nachhaltig erinnerungswürdige und im Denken stets gegenwärtige Erfahrungen gemacht haben. Wird diese Erinnerung wachgerufen – zum Beispiel dadurch, dass ich in der Ferne plötzlich mein eigenes Dialekt höre – , fühle ich mich nach Hause versetzt. Was immer man als die eigene Heimat bezeichnet: die Erinnerung an sie ist mit dem Wohlgefühl verbunden, das erlaubt, einfach da sein zu dürfen, ohne sich rechtfertigen oder verteidigen zu müssen. Heimat ist dort, wo der Mensch sich in Einstimmung und Einklang fühlt mit seiner Umgebung, wo er sich angenommen und behaust weiß. Heimat ist das wirkliche da-heim, Paradigma von Selbst-Sein in der Geborgenheit des aus sich Verständlichen. Was und wo das ist, erfährt man zumeist in der Abwesenheit, in der Fremde: als Heimweh nach dem Zuhause. Im Heimweh entdecken wir unsere Heimat.
In diesem Sinne ist der Gefühlsort von Heimat die Sprache – in der Regel die Muttersprache – , ein Landstrich, ein Haus oder eine ganze Stadt; Heimat kann aber auch eine historische Epoche sein, in der ich zu leben mir wünschte, ein Buch, ein Gedicht – kurz: jene geistige Heimat, die – für mich und manchmal nur für mich – zum Ausdruck bringt, wie ich mein eigenes Leben verstehen will: Das können Verse von Gottfried Benn sein, der Stechlin von Theodor Fontane, eine Kantate von Johann Sebastian Bach oder Heimito von Doderers Strudelhofstiege: Sie laden ein zur Identifikation mit einem Lebensgefühl, einer Weltsicht – und bringen auf ihre Weise eine Saite des eigenen Ichs zum Klingen, die der ganzen Person ihre Kontur verleiht. Und ganz nebenbei: Die genannten Beispiele verraten viel über das Gefühl von Heimat, wie es dem Verfasser zu eigen ist.
Heimat, so verstanden, ist demnach nicht zwingend die Bekräftigung der eigenen, tatsächlichen Lebens- und Herkunftsbedingungen, die manchmal auch einengen können oder sogar Verletzungen und Verwundungen wachrufen. Heimat ist eher und viel mehr ein Ort lebenslanger Sehnsucht – durchaus auch im Widerspruch zur Faktizität dessen, was mich umgab und umgibt. Wenn die eigenen Lebensumstände als feindselig oder zumindest als fremd wahrgenommen werden, können sie kaum das Gefühl der Beheimatung wecken; wenn sie unabänderlich wie ein Korsett mein Leben einpferchen, fühle ich mich kaum zu Hause. Heimat ist dann die Option einer Alternative zu jener Zwangsjacke, derer ein Mensch sich nicht entledigen kann, weil sie Bedingungen seiner Subsistenz sind. Die reale Subsistenz – der Alltagskampf ums Überleben – gerät dann in einen Widerspruch zur potentiellen Existenz – dem Ort meiner Sehnsucht – . In seiner besten Verfasstheit ist ein solcher alles Lebensfeindliche verbannender Entwurf der eines von Hoffnung getragenen Erfüllt- und Gerufen-Seins.
Nun schreibt Paulus im Brief an die Philipper, 3, 20: „Unsere Heimat aber ist im Himmel.“ Ein solcher Satz muss in einem Zeitalter des Säkularismus wie eine Provokation klingen. Aber man darf in diesem Satz beileibe kein paulinisch-christliches Sondergut sehen, denn in ihm versammelt sich ein wichtiger Teil des uns immer noch prägenden Erbes der Antike – im Rückgang bis zu den Quellen des römisch-lateinischen wie byzantinisch-griechischen Denkens an seinen frühen Anfängen. Platon, philosophischer Pate der europäischen Kultur bis heute, hat im Timaios, 90a, den Menschen beschrieben als ein Wesen, das seine Anker im Himmel hat. Und eben dieses Selbstverständnis des Menschen als ein Wesen, das nach oben blickt, hat Rémi Brague in seinem wichtigen Buch Les Ancres dans le Ciel – die deutsche Übersetzung Anker im Himmel erscheint gerade – zum Gegenstand gemacht. Es geht um das – nach Immanuel Kant – unabweisliche Bedürfnis des Menschen, über die eng gesteckten Grenzen dessen, was er wissen kann, hinauszublicken – auf jenen Ozean, wie Kant es im Bild beschreibt, der die Ufer unseres Wissens umspült und sich bis hin zum Horizont, an dem Meer und Himmel ineinander verschwimmen, weitet.
Dort, wo der Mensch vor Anker liegt, im ‚Himmel‘ also, findet sich seine Heimat, die er zeit seines Lebens nur aus der Ferne, die zugleich eine Fremde ist, erwartungsvoll in den Blick nehmen kann. Der Himmel ist jener Heimat-Hafen, auf den er Kurs nimmt, und die Lebensreise eine Art Himmelfahrt in die Heimat. Darüber nicht nachdenken zu wollen, bedeutet, hinter seinen Möglichkeiten zurück zu bleiben und die eigene Vernunft fahrlässig zu verkürzen. Denn ein Leben lang ist der Mensch auf der Suche nach seiner Heimat, er ist nie wirklich zu Hause, immer im Aufbruch auf dem Weg zur Erfüllung seiner Sehnsucht nach dem, was ihn übersteigt und was er nie erreicht, seinem Lebensglück: nämlich so zu sein, wie er sein möchte – und doch nie ist, so sehr er sich auch darum müht.
Ich finde diesen Gedanken sehr schön ausgedrückt in einem Gedicht des 1933 geborenen und am 10. Juli 2017 verstorbenen Peter Härtling – jenem Gedicht, das die Familie der Traueranzeige in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 15. Juli 2017 vorangestellt hat:
Glück
Nichts mehr,
was dich treibt,
nichts mehr,
was dich hält.
Auf den Hügel hinaus
und solange
nach innen singen,
bis die Stimme
dich aufhebt
und mitnimmt.