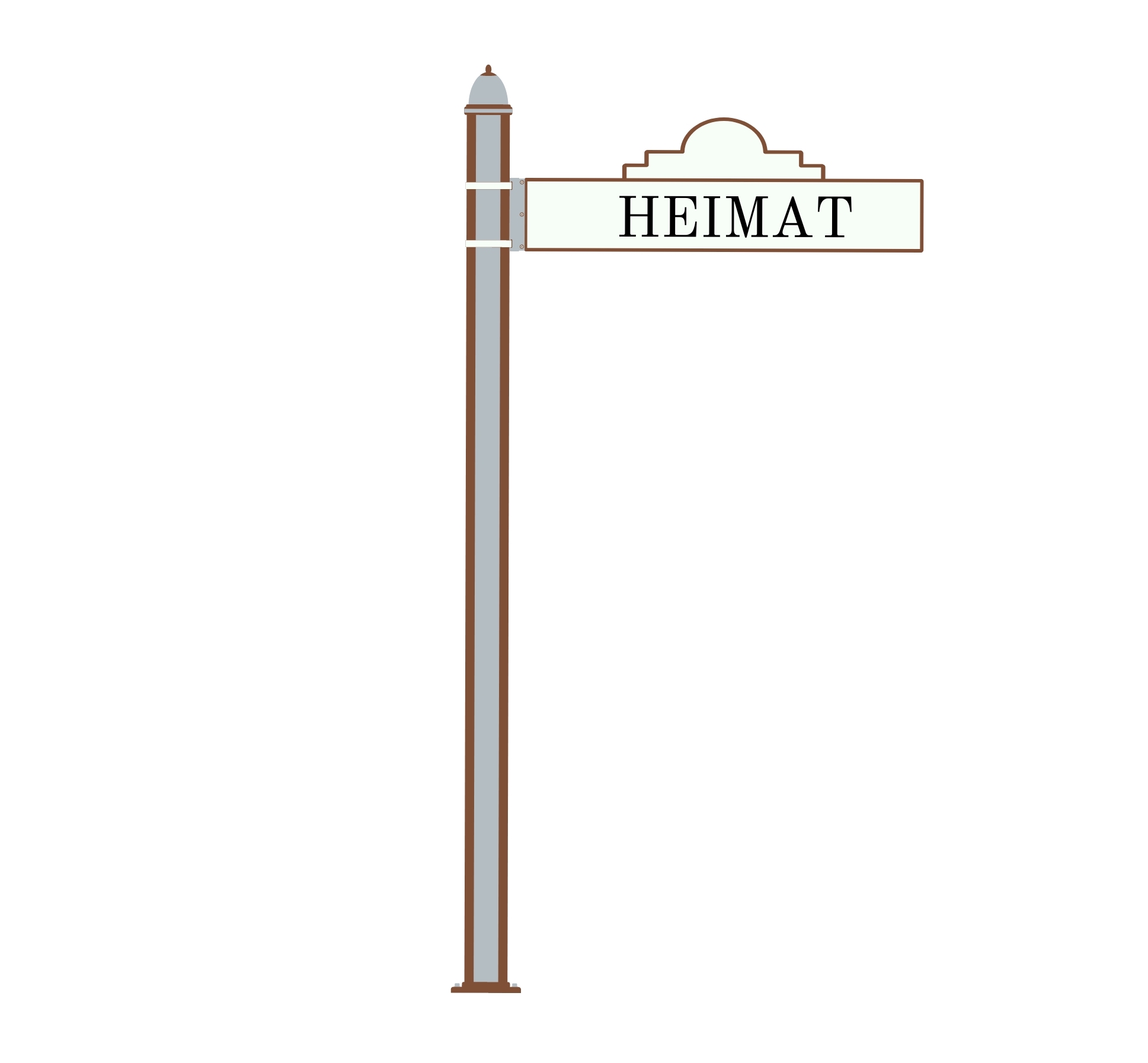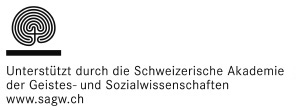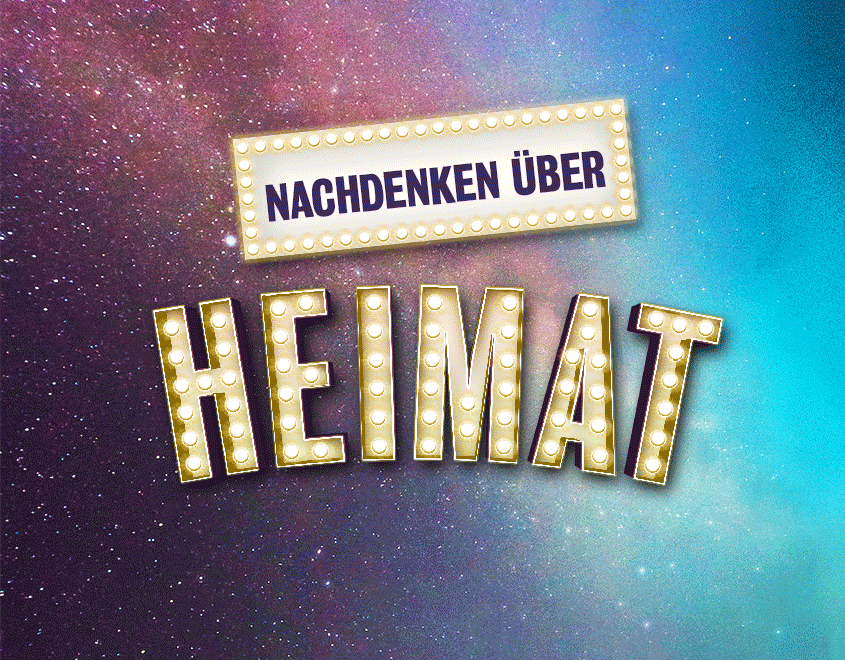Wenn ich an «Heimat» denke, überkommen mich zuerst Gefühle der Befremdung. Ich habe mich an dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, stets «heimatlos» gefühlt: umgeben von Menschen, mit denen ich mich weder identifizieren konnte, noch wollte; umgeben von Menschen, deren Idee von «Heimat» darin bestand, einen Ort auf der Welt zu haben, wo sie «hingehörten» und «herkamen», und die alle anderen Menschen danach beurteilten, wo deren «Heimat» (in diesem Sinne) war. «Heimat», das hatte für mich immer den bitteren Beigeschmack von einer tiefen Sehnsucht nach kultureller Homogenität und einem exklusiven Wir-Gefühl, einer fast schon narzisstischen Präferenz des Bekannten gegenüber dem Unbekannten, einer oftmals naiven Idealisierung der eigenen Lebensweise und Gemeinschaft.
Ich habe mich, an dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, immer als Aussenseiter gefühlt. Ich wollte das nicht, es tat weh. Ich war anders, obwohl ich dort seit meiner frühesten Kindheit lebte. Zuhause sprachen wir Englisch, an der Schule Hochdeutsch – ich habe den Dialekt nie erlernt, der mich wohl am ehesten zu einem «Einheimischen» gemachte hätte, der vermutlich die Grenze der gegenseitigen Fremdheit eingerissen hätte, die ich so oft im Umgang mit den Menschen erlebte, die sich dort «beheimatet» fühlten. Wie oft habe ich die Volksweisheit «In der Heimat ist es immer am schönsten» gehört, und mir gedacht: «Du kennst doch gar nichts von der Welt. Woher willst Du das wissen?»
Kaum dass ich erwachsen war, bin ich «ausgebrochen». Mein Zivildienst, mein Studium, alles sollte möglichst weit weg sein von «dort». Wenn ich zunächst noch häufig zurückkehrte, dann nur, um Freunde und enge Verwandte zu besuchen. Erst nach einigen Jahren und längerer Abwesenheit entdeckte ich ein mir unbekanntes Gefühl, als ich die Gegend meines Aufwachsens bereiste. Es hatte nichts mit den Menschen zu tun, die mir in ihrem Habitus kaum vertrauter erschienen als die Menschen in Indonesien, die ich kurz vorher kennengelernt hatte. Ich stellte fest, dass mir die Landschaft mit ihren bewaldeten Hügeln sehr gefiel.
In Ermangelung eines besseren Begriffs malte ich mir daraufhin aus, dass diese Freude an der Landschaft meiner Kindheit wohl eine Art «Heimatgefühl» sei. Ich dachte mir: Vielleicht ist es ja so, dass die meisten Menschen sich derart an die Umgebung gewöhnen, in der sie den grössten Teil ihres Lebens verbringen, dass sie eine gewisse Zuneigung zu dieser Umgebung entwickeln, die sie dann «Heimat» nennen. Später fand ich dann heraus, dass die psychologische Forschung in der Tat festgestellt hat, dass das Bekannte und einem selbst Ähnliche von Menschen generell bevorzugt wird: Ein häufiger Grund für Diskriminierung und Ausgrenzung, natürlich, aber unter Menschen mit relevanten Ähnlichkeiten eine gute Voraussetzung für die Kooperation.
Es dauerte einige Jahre, bis ich mich das erste Mal bewusst einer Gemeinschaft zugehörig fühlte. Ich kannte das Gefühl, einem engen Kreis von Freunden anzugehören, und sogar das Gefühl, mit gleichgesinnten Fremden einem gemeinsamen Hobby nachzugehen. Erst auf einer internationalen Konferenz stellte ich allerdings bewusst fest, dass ich mich mit einem bestimmten Schlag von Menschen «verbunden» fühlte. Egal, aus welchem Land sie kamen: mit Menschen, die Freude an wissenschaftlicher Forschung und Lehre hatten, «vereinte» mich etwas. Ich stellte fest, dass es eine Art Gemeinschaft gab, der ich mich «zugehörig» fühlte, in der ich mich «beheimatet» fühlte. Während meines Studiums hatte ich solche Gefühle nicht erlebt. Die wenigsten meiner Mitstudierenden teilten mit mir ein veritables Forschungsinteresse, identifizierten sich vielmehr mit der jeweiligen Praxis. Auch hier war ich mit meinen Interessen und Neigungen in der Minderheit gewesen, hatte mich als Aussenseiter erlebt, als «nicht zugehörig», wie schon so oft zuvor. Aber nun erkannte ich, dass auch ich eine «berufliche Heimat» hatte. Natürlich finde in nicht alle Wissenschaftler gleichermassen sympathisch, aber zumindest teilen wir alle – frei nach Thomas Kuhn – eine gewisse Neugier, die Sehnsucht nach einem tiefen Verständnis der Welt und ihrer vielfältigen Phänomene, den Wunsch nach Wahrheit und die Freude an der Lösung wissenschaftlicher «Rätsel».
Das tiefste Gefühl von «Heimat» habe ich allerdings in und durch die Liebe zu meiner Frau gefunden. Unabhängig davon, wo wir leben, wohin wir gemeinsam reisen, ob in Städten oder Dörfern, am Meer oder in den Bergen: an ihrer Seite bin ich «zu Hause». In unserer Zweisamkeit habe ich meine «wahre Heimat» gefunden.
Wenn ich jetzt solche Sprüche lese oder höre, wie «Heimat ist dort, wo das Herz ist», kann ich mich mittlerweile mit ihnen anfreunden. Wenn Menschen davon schwärmen, sich an diesem oder jenem Ort «beheimatet» zu fühlen, kann ich mich mit ihnen freuen. Ich bin mittlerweile sogar dazu in der Lage, zu unserem jeweiligen Wohnort und den dortigen Menschen eine gewisse «Heimatverbundenheit» zu entwickeln – eine selektive, allerdings. Ich habe begriffen, dass «Heimat» etwas ist, was ich subjektiv für mich selbst «konstruieren» kann, in Abhängigkeit von dem, was ich wertschätzen kann, und womit ich mich persönlich identifizieren möchte. Ich kann unseren aktuellen Wohnort mittlerweile als meine «Heimat» schätzen, und bringe durchaus gerne auch einen gewissen «Lokalpatriotismus» zum Ausdruck, wenn ich Menschen von ihm erzähle.
Was ich an unserem aktuellen Wohnort auch besonders zu schätzen weiss, ist die Offenheit vieler alteingesessener «Einheimischer», Neuzugezogene wie meine Frau und mich als Menschen anzuerkennen, die ihre «Heimat» hier gefunden haben – vorübergehend oder permanent. Was mich nach wie vor zutiefst verstört, sind Menschen, die mir sagen wollen, wo meine «Heimat» ist, z.B. da wo ich «herkomme»; Menschen, die ihre eigene Idee von Heimat vor allem hegen, um sich von anderen abzugrenzen, und andere an «deren Platz» zu verweisen.