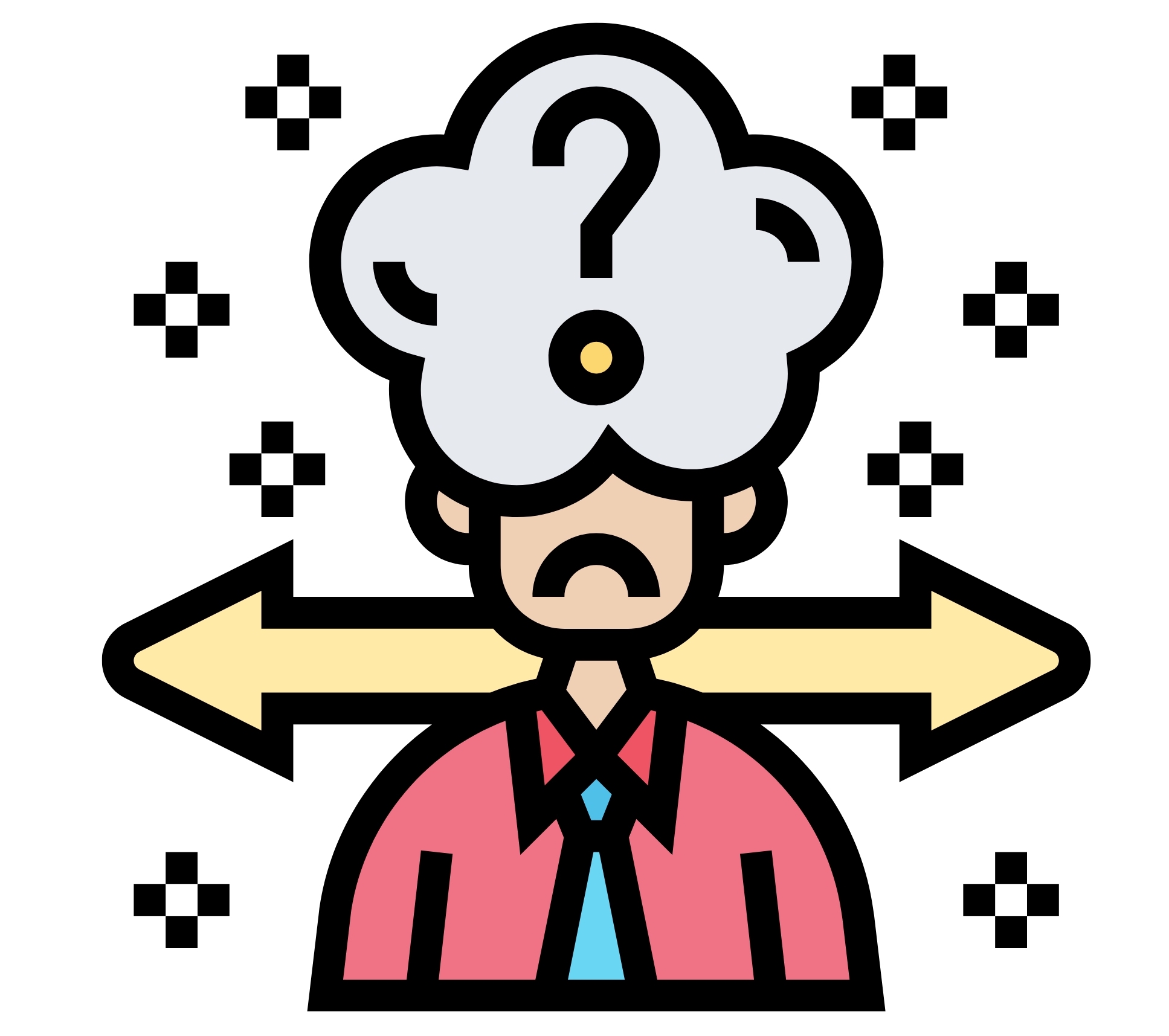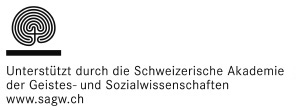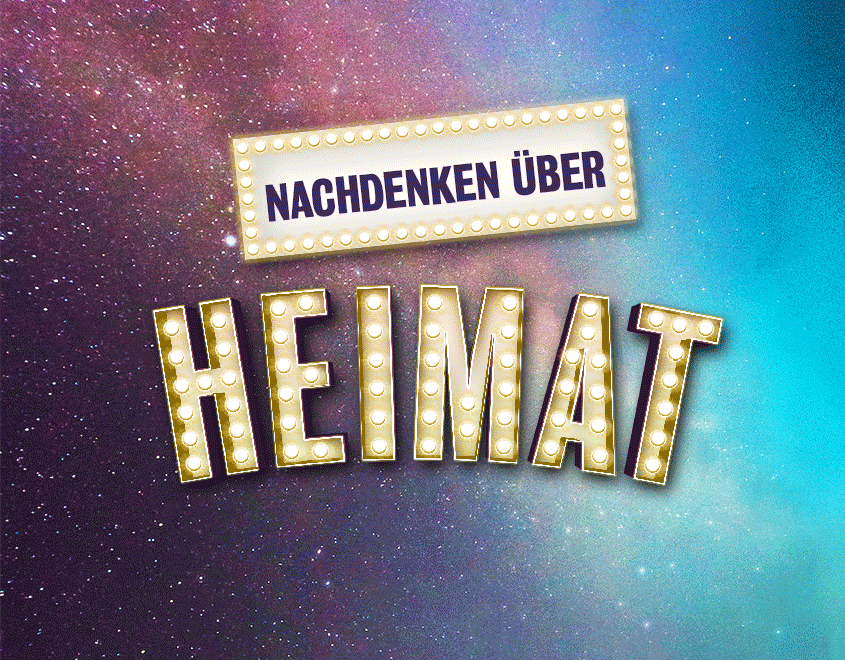Diskurse, in denen von Heimat die Rede ist, sind in aller Regel unappetitlich. Sie haben etwas Beschwörendes, Raunendes. Paradoxerweise etwas Verlorenes. Sie sind „hinterwäldlerisch“, wie man bisweilen despektierlich sagt. Sich auf sie einzulassen hat wenig Reiz. Zu offensichtlich sind die ideologischen Schlagseiten. Zu klar ist, welches politische Kapital sie erwirtschaften sollen. Dann muss es um Zurückweisung und klare Gegenworte gehen. Dabei mögen einem im Einzelfall die Gründe nachvollziehbar erscheinen, die jemanden dazu bringen, diese Töne anzuschlagen und in ihnen sein Heil zu suchen.
Einleuchtend sind nämlich die Gründe, die man anführt, um die Konjunktur der Heimatreden zu erklären. So hat etwa der Basler Kulturwissenschaftler Walter Leimgruber, Präsident der Eidgenössischen Migrationskommission, in der Rede zur Eröffnung der Heimat-Ausstellung im Stapferhaus diese Diskurse als Nebentöne der Globalisierung und als Reaktionen auf Angst und Überforderung gedeutet: Wo Arbeitsplätze ausgelagert werden, Generationengefüge sich verschieben und Migrationsströme den Alltag prägen, da sehnen sich Menschen nach überschaubaren, geordneten Verhältnissen.
Ein solcher soziologisch-kulturwissenschaftlicher Blick von außen ist wichtig, hilft er doch auch die eigene Überforderung mit den Überforderungskompensationsmechanismen der anderen, wie Odo Marquard diesen Mechanismus vielleicht gedeutet hätte, zu minimieren. Sind wir nicht oft sprachlos, sowohl angesichts des Tempos der Globalisierung, das auch uns betrifft, als auch angesichts der Art und Weise, wie andere auf diese Überforderungen reagieren? Gleichzeitig suggeriert dieser Blick von aussen, dass damit alles gesagt sei. Die Einsicht in die Rückwärtsgewandtheit der Heimat-Diskurse liesse dann nur einen Schluss zu: Man solle sich angesichts der Globalisierungsdynamik von dem Begriff verabschieden und damit leben lernen, dass zu deren Effekten auch der Verlust von Heimat gehört. Vieles, so das Versprechen, sei zur Stelle, was diesen Verlust kompensiere. Allerdings, wäre mit der Unterscheidung des britischen Journalisten David Goodharts anzumerken, tritt dies mehr auf Anywhere-People zu und weniger auf Somewhere-People, die nicht zu den beruflichen Eliten gehören und ihre Art Leben nicht grundsätzlich überall führen können.
Diese Sichtweise, die ein bestimmter Lebensstil nahegelegt, ist ebenso eingespielt wie die Diskurse, derer sie sich annimmt. Aber gibt es nicht vielleicht Gründe, den Begriff „Heimat“ nicht gleich mit zu verabschieden? Wie könnte man sonst Vertriebenen gerecht werden, die ihre Heimatlosigkeit beklagen? Wie Sätze von Exil-Schriftstellern würdigen, die sagen, sie hätten eine Heimat in der Sprache gefunden? Oder wie jene Wendung ins Utopische von Ernst Bloch am Ende seines Werkes Das Prinzip Hoffnung verstehen: "Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte, ja alles und jedes steht noch vor Erschaffung der Welt, als einer rechten. Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende, und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heißt sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfasst und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat." Legen diese Fälle nicht nahe, dass die eingangs skizzierte Sichtweise etwas ausblendet und dass der Preis, den man mit dem gänzlichen Verzicht auf den Begriff „Heimat“ bezahlen würde, hoch sein könnte? Nicht umsonst gibt es eine lange Tradition der Linken, die versucht, den Begriff für sich zurückzugewinnen und ihn aus der Verklammerung mit dem Reaktionären zu befreien. Max Frisch ist ein prominentes Beispiel für die Schweiz. Diese hat bekanntermassen ja eine besondere Liaison mit dem Begriff, weshalb Heimweh lange Zeit als Maladie Suisse bezeichnet wurde, was den Basler Arzt Johannes Hofer um 1688 zur Neuschöpfung des Wortes „Nostalgie“ für das Syndrom dieser vor allem unter Reisläufern verbreiteten Heimwehkrankheit führte. Angesichts der Wahlerfolge von Parteien am rechten Parteienspektrum in Ländern mit ganz unterschiedlichen Herkunftsprägungen, nach Brexit und Trump mehren sich in letzter Zeit aber auch international die Stimmen, die von Versäumnissen sprechen: Die Linke müsse, um mit René Cuperus, dem Direktor des niederländischen Think Tanks der Arbeiterpartei, nur eine Stimme zu nennen, statt von Multi- und Transkulturalismus zu schwärmen, die konkreten Probleme zum Thema machen, den Rückbau des Wohlfahrtsstaates ebenso wie die Bedenken einwandungskritischer Stimmen, die Stellung des Islams in den westlich-demokratischen Gesellschaften oder die Spannung zwischen nationaler und internationaler Solidarität.
Dass der Begriff „Heimat“ angesichts komplexer Lebenswege zunehmend schwer zu gebrauchen ist, sei geschenkt. Die Gründe, die dazu führen, können ganz unterschiedlich sein: Krieg, Vertreibung, Hunger, aber auch weniger dramatische wie Studium, Beruf oder der Ruf der Liebe. Oder schlicht die Zufälle der Lebensläufe in einer mobilen offenen Gesellschaft, die Fakten schaffen können, die im Nachhinein zu einer Verschiebung dessen führen, wo man seine Heimat sieht. Trotzdem ist der Anteil an Menschen, die ihr Leben lang sich relativ wenig bewegen erstaunlich hoch. Unvergessen meine Reise entlang des Mississippi neulich und die Einsicht, dass die Hälfte der Menschen in der Region in ihrem ganzen Leben einen Umkreis von 50 Meilen kaum verlässt.
Allerdings stellt uns schon die Übersetzung von „Heimat“ vor Probleme: So haben die Äquivalente pays natal (ähnlich wie im Italienischen paese natale oder das Englische native country, home town) nicht die emotionale Färbung von „Heimat“. Und in den auf das lateinische patria zurückgehenden Alternativen schwingt immer schon das süsse Sterben fürs Vaterland mit. Nicht umsonst gibt es einen entsprechenden Eintrag in Barbara Cassins Vocabulaire européen des philosophies, einem Wörterbuch, das philosophische Begriffe anführt, die der Übersetzung Widerstand leisten, weshalb der Untertitel lautet: „Dictionnaire des Intraduisibles.“ Heimat, heisst es dort, sei zunächst die Zugehörigkeit durch Geburt und politische Gemeinschaft und insofern deckungsgleich mit „Vaterland“. Gleichzeitig meine es aber auch ein „enracinement ontologique“, eine bestimmte Art des In-der-Welt-Seins – und diese, so kann man anfügen, ist nicht unbedingt dort zu finden, wo man herstammt, gerade auch im Fall von Entwurzlungen. Andererseits machen Formen des Vaterlandsverlustes besonders sensibel für die Frage, welche politische Legitimität die Art von Verwurzelung hat, die wir Heimat nennen können.
Ernst Blochs berühmte Schlusswendung dreht den Begriff ins Politisch-Utopische, verbindet ihn aber gleichzeitig mit der Kindheitserfahrung eines Lebens ohne Entäusserung und Entfremdung. „Kindheit“ wird hier zum poetischen Bild für die Möglichkeit einer solchen Erfahrung, auch wenn gerade die Kinder unter den Vertriebenen und Heimatlosen die Ersten sind, die dieser Wendung ins Utopische Hohn sprechen. Wäre es falsch zu fragen, ob nicht selbst im Unappetitlichen der Heimatdiskurse sich etwas von dieser Utopie artikulieren könnte? Ob nicht im blindwütigen Insistieren auf den Kosten der von der Ausbreitung der Märkte getriebenen Globalisierung sich etwas von den ernsthaften Wunden zeigt, die diese Märkte schlagen? Ob sie nicht auch als Ausdruck einer Form des Widerstandes zu lesen wären, der auf ein anderes Leben verweisen würde, ein Leben jenseits einer universellen Konsum- und Tauschlogik? Um der Dämonisierung dieser Diskurse entgegenzuwirken, wäre das bestimmt eine fruchtbare Hypothese, die die Arbeit der einen Hand lenken könnte, während die andere die Gefechte ficht, zu denen uns die Dämonen dieser Diskurse herausfordern.