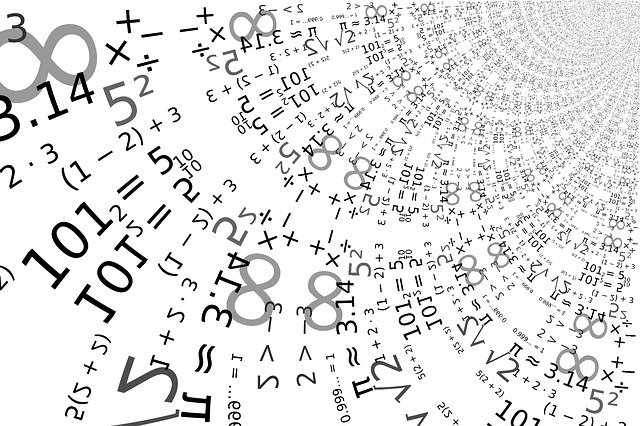Wenn doch alle Dinge so eindeutig wären wie in der Mathematik. Klare Regeln der Beweisführung, lückenlose Argumentation, zu jeder Frage genau eine richtige Antwort. Kein Platz für Uneinigkeit, sobald ein Beweis steht. Die Mathematik verkörpert für viele das Ideal eines widerspruchsfreien Gesamtbilds – ein Ideal, an dem sich nicht nur die Naturwissenschaften, sondern auch alle anderen Diskursbereiche orientieren, die den Anspruch auf Objektivität erheben. Fragen wie „Welche Religionen gehören zu Deutschland?“, „Ist Sicherheit wichtiger als Freiheit?“ oder „Dürfen wir das menschliche Erbgut manipulieren?“ werden in der Überzeugung diskutiert, man sei auf der Suche nach genau einer, nämlich der richtigen Antwort. Die Pluralismusdebatte in der Grundlagenmathematik zeigt, dass diese Überzeugung möglicherweise falsch ist.
Das mathematische Ideal beherrscht unser Denken seit Jahrtausenden. Zwar entwickelten sich die frühe mesopotamische und ägyptische Mathematik in Konsequenz praktischer Bedürfnisse von Zivilisationen, wie zum Beispiel Besteuerung, Messung von Landflächen, Berechnung von Mondkalendern usw. Angesichts ihrer Exaktheit schrieb die Philosophie der Mathematik jedoch bald eine weitere Rolle zu, nämlich die eines Paradigmas für menschliches Denken und Wissen. Platon betrachtete die Mathematik als höchste Form des Wissens, die sich als solche deutlich von unseren unsicheren Ansichten über die empirische Welt unterscheidet. Er glaubte, dass mathematisches Wissen im Wissen über ewige „Formen“ besteht – perfekte Ideen, die die ultimative Realität darstellen – und er sah mathematische Kompetenz als unerlässlich für den Erwerb von Wissen überhaupt an. Galilei betrachtete die Mathematik als die „Sprache des Buches der Natur,“ Kant argumentierte, dass die Mathematik wesentliche Einblicke in eine ganze Gattung menschlicher Urteile möglich mache, Cantor fand Gott in den transfiniten Zahlen... Kurz: die Vorstellung, die Mathematik sei der Schlüssel zum Verständnis der Grundstrukturen der Realität beherrscht die Philosophie seit Jahrtausenden.
Im 19. Jahrhundert änderte sich dieses Bild dramatisch. Durch die Einführung von Begriffen mit geringer oder gar keiner physischen Bedeutung löste sich die Mathematik von der empirischen Welt. Komplexe Zahlen, n-dimensionale Räume, abstrakte Algebren, pathologische Funktionen und nicht-euklidische Geometrien begannen sich als Objekte mathematischen Interesses zu etablieren. Infolgedessen „explodierte die Mathematik in hundert Gebiete“, wie es der Mathematikhistoriker Morris Kline formulierte, und dies führte zu einer tiefgreifenden Veränderung des Verständnisses ihrer Beziehung zur Welt. Die Empiriker des Wiener Kreises betrachteten die Mathematik einfach als nützliches Werkzeug für die Naturwissenschaften, dessen Sätze nichts über die Welt aussagen und allein aufgrund sprachlicher Konventionen als wahr zu betrachten sind. Die Sichtweise, dass der Schlüssel zu den ultimativen Wahrheiten der Realität nicht etwa in der Mathematik, sondern allein in den empirischen Wissenschaften zu finden ist, setzte sich durch. Die Mathematik war tief gefallen, von Platons Himmel der perfekten Formen in den glanzlosen Werkzeugkasten der Naturwissenschaftler.
Im 20. Jahrhundert stellten die Entwicklungen in der modernen Mengenlehre dieses Bild wiederum auf den Kopf. Durch bahnbrechende Beweise und Axiomatisierungen kristallisierte sich heraus, dass die Mengenlehre ein Fundament für die gesamte Mathematik darstellt. Plötzlich konnten sogar die unterschiedlichsten der "hundert Gebiete" der Mathematik in einem einheitlichen Rahmen interpretiert und auf Kohärenz getestet werden. Unklare Begriffe und Strukturen wurden präzisiert; die grundlegenden Annahmen, die in verschiedenen Formen in verschiedenen Gebieten gemacht wurden, konnten identifiziert werden, und durch ihre neue einheitliche Darstellung wurden bis dato verborgene Zusammenhänge zwischen verschiedenen Gebieten der Mathematik sichtbar. Platons Vision hatte sich in gewissem Sinne bewahrheitet: die Mathematik hatte ihre eigenen Fundamente entdeckt und sich, wie der Mathematiker David Hilbert es beschrieb, zu einem autonomen "Paradies" entwickelt, an deren unüberbietbarer Exakt- und Gewissheit sich jede andere Wissenschaft und jeder Diskurs messen muss.
Heute, im frühen 21. Jahrhundert, wissen wir allerdings, dass sogar Paradiese unvollkommen sind: unzählige mathematische Hypothesen sind in dem mengentheoretischen Axiomensystem „ZFC“, das das Fundament aller Mathematik darstellt, nicht entscheidbar. Und es ist nicht einmal klar, ob es auf jede dieser offenen mathematischen Fragen wirklich nur genau eine richtige Antwort gibt. Am notorischsten unter den offenen Fragen ist die Kontinuumshypothese, aufgestellt 1878 von Cantor, im Jahr 1900 auf Platz 1 der Liste der 23 wichtigsten offenen mathematischen Fragen gesetzt und bis heute ungelöst. Cantor hatte bewiesen, dass es unterschiedlich große unendliche Mengen gibt, oder genauer: dass die Menge der reellen Zahlen überabzählbar, ihre Mächtigkeit also größer als die der natürlichen Zahlen ist. Die Kontinuumshypothese drückt vor diesem Hintergrund die Vermutung aus, dass es keine unendlichen Mengen gibt, die größer als die Menge der natürlichen Zahlen, aber kleiner als die Menge der reellen Zahlen sind.
Einige Mathematiker glauben, dass die Kontinuumshypothese einen definitiven Wahrheitswert hat, dass sie also entweder wahr oder falsch ist. Hugh Woodin zum Beispiel, Professor der Mathematik und der Philosophie an der Harvard University, ist von der Wahrheit der Kontinuumshypothese überzeugt. Seit 2010 arbeitet er an der Konstruktion eines inneren Modells des mengentheoretischen Universums, die – wenn sie gelänge – eine mathematische Sensation wäre. Nicht nur, weil sie die Wahrheit der Kontinuumshypothese bestätigen würde, sondern auch, weil sie ein ordentliches, elegantes und überschaubares Bild der unendlichen Hierarchie von Mengen zeichnen und somit unser Verständnis der inneren Struktur von Unendlichkeit revolutionieren würde.
Jedoch befürworten nicht alle Mathematiker diese Herangehensweise. Mengentheoretiker wie zum Beispiel Stevo Todorcevic von der University of Toronto sind davon überzeugt, dass die Kontinuumshypothese falsch ist. Sie bevorzugen die "forcing"-Methode, eine mathematische Technik, mit der unendlich viele mengentheoretische Universen definiert werden können, um offene Fragen in ihnen zu beantworten. Mit dieser Technik lässt sich zwar zeigen, dass die Kontinuumshypothese falsch ist; aus philosophischer Perspektive hat die "forcing"-Methode allerdings rein pragmatischen Wert, fördert sie doch nicht unser Verständnis der inneren Struktur von Unendlichkeit.
Entgegen der weitverbreiteten Meinung, in der Mathematik gäbe es auf jede Frage genau eine richtige Antwort und somit keinen Platz für Dissens, herrscht also de facto Uneinigkeit nicht nur über die beste Beweistechnik für mengentheoretische Vermutungen und deren Wahrheitswerte, sondern auch darüber, wie wir einige der grundlegendsten mathematischen Begriffe (wie zum Beispiel „Menge“ oder „Unendlichkeit“) überhaupt verstehen sollten. Manche Mathematiker fühlen sich gar an „religiöse“ oder „schismatische“ Kontroversen erinnert.
Im Gegensatz zur Religion (oder auch der Politik) begegnet die Mathematik den ihr immanenten Uneinigkeiten allerdings sehr gelassen. Kein Mengentheoretiker würde in Hysterie oder wüste Beschimpfungen verfallen, nur weil ein Kollege das komplette Gegenteil dessen verteidigt, was er selbst glaubt. Und das, obwohl es um die fundamentalsten Wahrheiten der vielleicht fundamentalsten Wissenschaft geht. Im Gegenteil, die mathematische Avantgarde argumentiert derzeit sogar dafür, das Ideal eines einheitlichen, widerspruchsfreien Gesamtbilds endlich aufzugeben und sich der Tatsache des in der Grundlagenmathematik bereits praktizierten mathematischen Pluralismus zu stellen.
Vorreiter dieses Ansatzes ist der Mengentheoretiker Joel Hamkins, Professor der Logik an der Fakultät für Philosophie der University of Oxford. Er plädiert dafür, die Jagd nach dem einen richtigen Axiomensystem aufzugeben, mit dessen Hilfe die Mathematik alle offenen Fragen endgültig und eindeutig beantworten könnte. Stattdessen ruft er dazu auf, die Tatsache zu akzeptieren, dass die Mathematik kein Universum, sondern ein Multiversum ist, bestehend aus unendlich vielen, teilweise sehr unterschiedlichen Subuniversen, und dass die Entscheidung, mit welchem dieser Subuniversen sich ein individueller Mathematiker befassen sollte, unter rein pragmatischen Gesichtspunkten getroffen wird. Zwar impliziert diese Herangehensweise eine drastisch veränderte Sichtweise auf das, was wir ‚mathematische Realität’ nennen. Im Ausgleich dazu trägt sie allerdings einem de facto bereits bestehenden Zustand Rechnung.
Wenn selbst die Mathematik, das Paradies der Exakt- und Gewissheit, solche Uneinigkeiten aushält, könnten wir dann nicht auch in Diskursen, die sich mit weit weniger präziser Materie befassen, eine mindestens ebenso große Gelassenheit an den Tag legen? Die Pluralismusdebatte in der Grundlagenmathematik zeigt, wie wichtig es ist, Spannungen auch über lange Zeiträume aushalten zu können. Im Extremfall kann es Jahrhunderte dauern, bis die richtige Antwort auf eine schwierige Frage gefunden ist. Und manchmal entsteht die richtige Antwort auch gar nicht aus theoretischen Überlegungen, sondern aus dem, was sich praktisch bewährt. Vielleicht geht man unlösbar scheinende Fragen, auch wenn sie die fundamentalsten Aspekte des menschlichen Daseins berühren, also am besten pragmatisch, und nicht dogmatisch an.
Dieser Beitrag erschien zuvor in abgeänderten Form in der Süddeutschen Zeitung.
Zum Original-Beitrag: https://www.sueddeutsche.de/kultur/streitkultur-debattenkultur-diskurs-mathematik-1.4276258