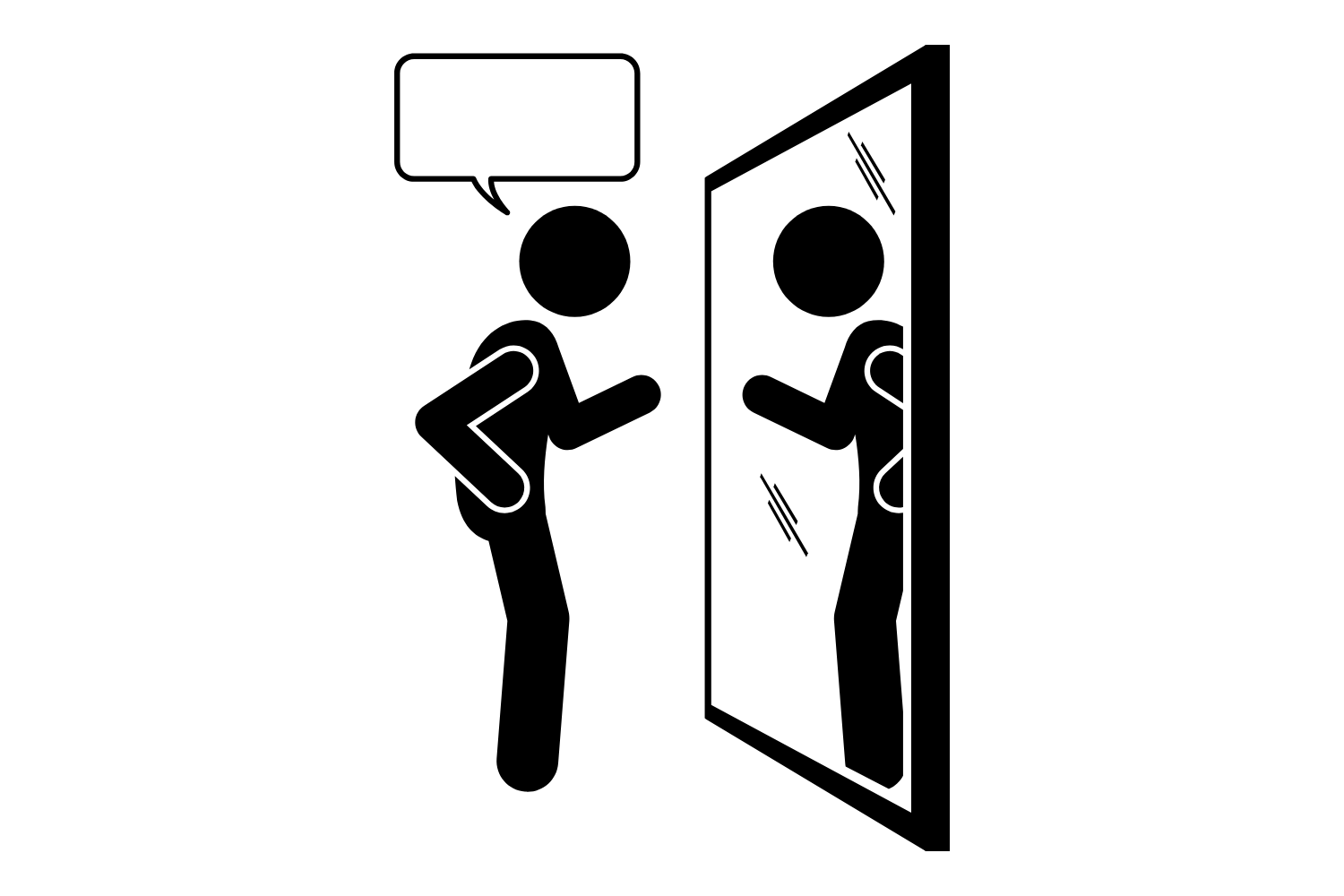Dem Erzählen wird zugeschrieben, verschiedene Funktionen zu erfüllen, z. B. bei der Orientierung in der Welt zu helfen oder Empathie zu erlernen. Und manchmal wird auch gesagt, dass Erzählen eine Funktion in Bezug auf die Identitätsbildung von Menschen habe. Der Ausdruck „Identität“ hat verschiedene Bedeutungen, insbesondere wenn man sowohl das alltägliche als auch das philosophische Sprechen betrachtet. Hier ist mit „Identität“ aber in der Regel dasjenige gemeint, was einen einzelnen Menschen zu diesem ganz bestimmten, besonderen Menschen macht. Hiermit soll Erzählen etwas zu tun haben. Dabei wird nicht an das Erzählen von irgendetwas gedacht, Blumen, Vögeln oder historischen Großereignissen, sondern an das Erzählen von jemandem. Dass man von jemandem erzählt, soll etwas damit zu tun haben, wer jemand ist. Das ist die Grundidee einer narrativen Identität. „Etwas zu tun haben mit“ ist allerdings zu ungenau, die eigentliche Grundidee ist stärker. Das Erzählen von jemandem soll demnach wesentlich dafür sein, wer jemand ist. Eine Antwort auf die Frage, was einen Menschen als genau diesen Menschen auszeichnet, soll in dem Erzählen von ihm bestehen.
Das hat bestimmte Folgen dafür, was man sich darunter vorzustellen hat, was jemanden als genau diesen besonderen Menschen auszeichnet. Von einem lebendigen Menschen zu erzählen, ist ein nicht abgeschlossener Vorgang – im Unterschied zum Erzählen von einem bereits Toten. Das heißt, dass jemandes narrative Identität ständig weitergesponnen wird. Es gibt keine abgeschlossene Antwort auf die Frage, was jemanden zu genau diesem Menschen macht. Die narrative Identität ist deshalb eine dynamische Identität. Die Erzählungen haben kein Ende, sie reichen in die Zukunft hinein und können sich beim Weiterspinnen verändern. Das, was jemandem wesentlich ist, ist nichts Feststehendes, sondern etwas, das sich immer wieder ändern kann.
Allerdings sollten die Änderungen nicht so weit gehen, dass man jemanden nicht mehr als denselben wiedererkennen kann. Ein Grundgedanke in Konzeptionen narrativer Identität ist, dass das, was jemanden zu genau diesem besonderen Menschen macht, nicht jemandes Körper ist oder jemandes biologisches Leben. Es ist vielmehr die Erzählung. Das heißt weitergedacht, dass jemand zwar im selben Körper wie ein anderer sein kann, aber tatsächlich jemand anderer ist. Er sieht aus wie der andere, ist aber tatsächlich ein eigener Mensch. Die Grenzen eines Menschen werden von der Erzählung bestimmt, sie werden nicht durch etwas anderes festgelegt. Jemand ist nur so lange derselbe, wie er eine Geschichte von sich erzählt. In dieser können Brüche vorkommen, sie muss trotzdem von demselben Menschen handeln. Wenn das nicht mehr der Fall ist, handelt es sich um jemand anderen.
Das wirft die Frage auf, wer eigentlich die Erzählung erzählt. In den meisten Konzeptionen narrativer Identität wird hier die Perspektive der ersten Person hervorgehoben. Das, was jemanden zu genau diesem besonderen Menschen macht, ist demnach nicht etwas, was irgendjemand von ihm erzählt, sondern das, was er selbst von sich erzählt. Wenn jemand von sich eine Erzählung gibt, die sich nicht über den Zeitraum eines gesamten biologischen Lebens erstreckt, weil er sich z. B. mit dem Kind, das er einst war, nicht mehr identifizieren kann, so gilt er hiernach tatsächlich als ein anderer als das Kind. Eine narrative Identität ist in diesem Sinn konstruktivistisch.
Das heißt nicht, dass andere keinen Einfluss darauf haben, wer man ist. Dem Einfluss anderer wird in diesen Konzeptionen schon dadurch Rechnung getragen, dass die Identität eine bestimmte Form haben soll. Es geht nicht darum, dass jemand irgendetwas über sich sagt, sondern es geht ja eben darum, dass jemand von sich erzählt. Erzählen ist aber eine sprachliche Tätigkeit, die sich von anderen solchen Tätigkeiten abgrenzen lässt, und die bestimmten Konventionen unterliegt. Insofern ist das Erzählen von sich selbst immer schon von anderen geprägt. Außerdem wird natürlich auch in diesen Konzeptionen nicht übersehen, dass Menschen unter anderen Menschen leben und die verschiedenen Leben miteinander verwoben sind. Aber in der Erzählung gilt es gerade, sie auch wieder voneinander zu trennen, so dass sichtbar wird, was wesentlich zu jedem Einzelnen gehört.
Die Grundidee einer Konzeption narrativer Identität besagt demnach, dass die Antwort auf die Frage, was jemanden zu genau diesem besonderen Menschen macht, in dessen Erzählung von sich selbst besteht. Es handelt sich dabei um eine dynamische Identität, deren Dauer nicht mit der eines biologischen Lebens gleichgesetzt werden kann, für die die Perspektive der ersten Person von besonderer Bedeutung ist, ohne dass deshalb der Einfluss, den andere auf jemanden haben, verleugnet wird.
So intuitiv plausibel vieles an dieser Konzeption ist, hat sie auch offensichtliche Probleme. Eins der gewichtigsten liegt in der einseitigen Betonung der Perspektive der ersten Person. Auch ist nicht klar, wie sich jemandes narrative Identität zu seinem biologischen Leben verhält. Es gibt erstere nicht unabhängig von letzterem, trotzdem soll sie unabhängig davon gedacht werden. Das erscheint nahezu unmöglich. Aber trotz dieser und weiterer Probleme, die sich mühelos aufzählen ließen, enthält die Idee einer narrativen Identität spannende Aspekte. Was jemanden zu genau diesem besonderen Menschen macht, hat unter anderem wesentlich damit zu tun, wie jemand sich selbst sieht. Dies kann in einer Erzählung zum Ausdruck kommen. Meines Erachtens scheitert die Idee einer narrativen Identität letztlich zwar aus Gründen, die hier nicht einmal angedeutet wurden, aber sie bleibt eine spannende Konzeption und man kann aus der Beschäftigung mit ihr vieles darüber lernen, wie Menschen tatsächlich sind.