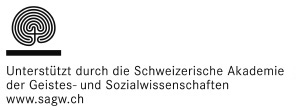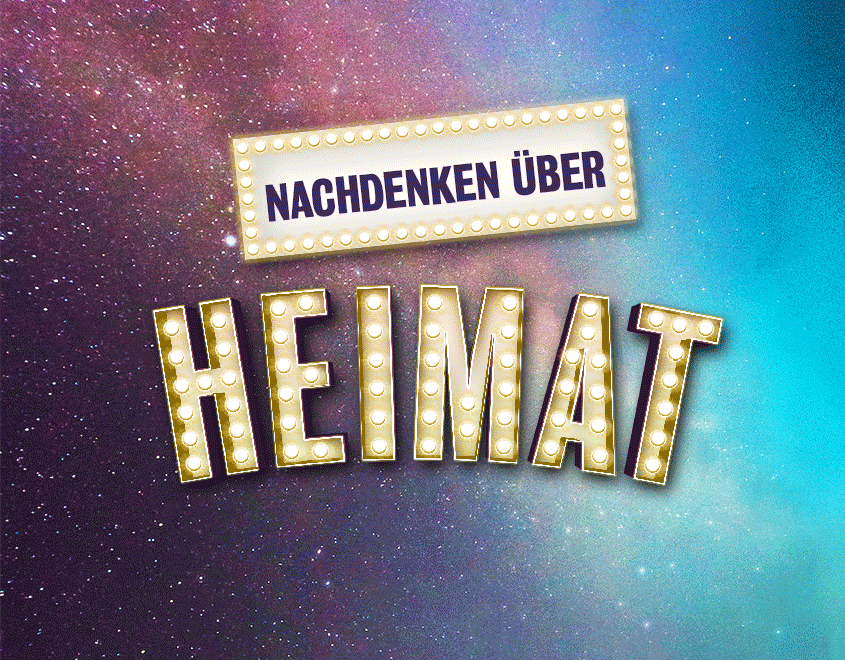„Home is where your wi-fi connects automatically“, so ein Satz könnte man eingerahmt an der Wand eines Berliner Cafés lesen. „Home“ ist dort, wo sich das Wifi automatisch verbindet, oder mit anderen Worten „Home“ ist dort, wo man kein Pass-wort (mehr) braucht, um sich zu verbinden, weil man das Passwort schon kennt, weil man das Passwort schon besitzt.
So bleibt das Zuhause mit der Kenntnis des Pass-wortes gleichgesetzt. Im Passwort steckt das Wort „passen“ – und passen ist hier in seinem etymologischen Sinne aus dem Französischen zu verstehen: passer, (aus dem Latein passare), d.h. sich von einem Ort zum anderen bewegen.[1]
Was bedeutet denn, dass das Zuhause oder die Heimat derjenige Ort ist (und es handelt sich um einen Ort, da “where” fragt und auf den Locus im Raum hinweist), in dem das Pass-wort bekannt oder jedenfalls nicht (mehr) nötig ist, in dem die Verbindung mit dem Netz automatisch funktioniert?
Automatisch kann hier mit unmittelbar übersetzt werden, d.h. ohne Mittel, ohne erforderte und erfragte Pass-wörter. Kein Reise-pass, kein Visum ist nötig zu Hause. Hier ist das S(ch)ibboleth ein geteiltes Geheimnis. Hier wird nicht nur das Passwort gekannt, sondern hier kennen wir auch das Savoir-faire, das Know-how. Wir wissen, wie es gesagt werden muss: ohne Akzent. Hier zu Hause, zwischen uns, sind die Pass-wörter nicht mehr nötig, weil wir kennen und sagen können, wie es sich gehörte:
La différence phonématique entre shi et si [...] devient ce qu’il faut savoir reconnaître et surtout marquer pour faire le pas, pour passer la frontière d’un lieu ou le seuil d’un poème, se voir accorder un droit d’asile ou l’habitation légitime d’une langue. Pour ne plus y être hors la loi.[2]
Und, um eine Sprache zu bewohnen, sagt Derrida weiter – sowie auch einen Ort – füge ich hinzu, muss man schon über das Schibboleth verfügen. Schibboleth ist die chiffrierte Markierung, die den Durchgang von einer Seite zur Anderen sicherstellt, aber nicht für die Efraimiter. Für diese ist Schibboleth das unaussprechbare Wort:
Gilead besetzte die nach Efraim führenden Übergange über den Jordan. Und wenn efraimtische Flüchtlinge (kamen und) sagten: Ich möchte hinüber!, fragten ihn die Männer aus Gilead: Bist du ein Efraimiter? Wenn er Nein sagte, forderten sie ihn auf: Sag doch einmal ‚Schibboleth’. Sagte er dann ‚Sibboleth’, weil er es nicht richtig aussprechen konnte, ergriffen sie ihn und machten ihn dort an den Furten des Jordan nieder.[3]
Schibboleth ist das, was man erkennen und markieren können muss, um den Schritt (den Pass) zu machen, um von einer Seite zur anderen Seite schreiten zu können. Es ist die differenzielle Markierung – die nicht dasselbe ist wie die Differenz –, das unaussprechbare Wort. Die differenzielle Macht ist im Körper eingetragen, im eigenen Körper der Sprache. Es handelt sich nicht um eine organische oder natürliche Fähigkeit. Ihr Ursprung setzt die Zugehörigkeit zu einer historischen, kulturellen und sprachlichen Gemeinschaft voraus, zu einem Lern-Milieu.[4]
Zwischen uns gibt es keine Mittel. Zwischen uns wissen wir, wie der Schritt gemacht werden muss. Durch und wegen Wiederholung, durch und wegen Gewohnheit. Denn es geht um das automatische oder automatisierte Bewohnen der Heimat: Habitare ist ein frequentatives Verb von habere, d.h. von haben. So ist habitare das Wieder-und- wiederhaben. Daher bewohnt man einen Ort und besucht ihn nicht. Gewohnt wird nur dann, wenn man genug am selben Ort bleibt. Lange genug, um das Savoir-faire erlernen zu können. Lange genug, um sich automatisch zu verbinden. Lange genug... wenn es dabei überhaupt um eine Frage der Zeit geht...
Automatisch bezieht sich auf die Fiktion, die das habitare in sich trägt. Diese Fiktion ist die Gefahr der Naturalisierung und der Normalisierung, um die jede identitäre Konstruktion bittet; die sich durch das Gespenst der Zugehörigkeit behält und die eine Aneignung der Sprache und ihrer Normen erfordert.
Die Heimat ist dort, wo man sich mit seinem Eigenen trifft. Sie ist dort, wo die Zugehörigkeit sicher ist. Mit einem singulären Gefühl wie beim Idiom verfällt die Heimat der Gefahr der Normalisierung. Die Heimat, sowie bei der Sprache, öffnet das Paradox zwischen dem Eigenen und dem Nicht-Aneigbaren. Es handelt sich um das Paradox, das Derrida in einer prägnanten Idee ausdrückt: „[J]e n’ai qu’une langue et ce n’est pas la mienne [...]. Ma langue, la seule que je m’entende parler et m’entende à parler, c’est la langue de l’autre.“[5]
Die Sprache kommt aus dem Anderen zu uns, ihre Regeln, ihre Orthographie und Grammatik wird mit Gesetzeskraft durchgesetzt. Dennoch ist die Forderung der Aneignung, die Forderung die Sprache richtig zu sprechen, die Sprache richtig zu schreiben, mit dem Idiom, mit dem Eigenen konfrontiert. Das Idiom fügt einen fremden Körper ein, um die Sprache von der behauptenden Homogenität zu enteignen. Die Heimat, sowie die Sprache, ist kein Naturgut. Die einzige Weise, um sie uns anzueignen, ist es durch das Vortäuschen, dass man sie aneignen kann, um sie als eigene aufzudrängen. Man spricht nur eine Sprache, man hat nur eine Heimat, ein Chez-soi, aber man besitzt sie nicht. Eine Identität ist nie gegeben oder ganz verwirklicht. Sie wird nie erreicht. Die Identität geht durch den gespenstischen Prozess der Identifizierung durch.
So ist laut Derrida das Unterschreiben der Sprache im Singular die einzige Weise, um die Sprache zu enteignen und den Patriotismen und Nationalismen nicht nachzugeben. Und so ist es auch vielleicht das Unterschreiben im Singular von dem Eigenen, das nicht anzueignen ist, die einzige Weise, um nicht in eine Logik der Gemeinschaftsidentifizierung zu verfallen. Es bleibt dann mit Derrida zu sagen: „Compatriotes de tous les pays, poètes- traducteurs, révoltezvous contre le patriotisme!“[6]
[1] Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm u. Wilhelm Grimm. Verlag von S. Hirzel (Leipzig, 1954) Online Version. Band 13 S. 1485 2 Jacques Derrida. Schibboleth pour Paul Celan. Galilée, (Paris, 1986). S. 50
[2] Jacques Derrida. Schibboleth pour Paul Celan. Galilée, (Paris, 1986). S. 50
[3] Die Bibel. Altes Testament. Richter. Herder (Freiburg im Breisgau, 2004) S. 12 5-6
[4] Jacques Derrida. Schibboleth pour Paul Celan. Galilée, (Paris, 1986) S. 50-1
[5] Jacques Derrida. Le Monolinguisme de l’autre ou la Prothese d’origine. Éditions Galilée. Paris (1996) S. 47
[6] Jacques Derrida. Ebd. S. 107