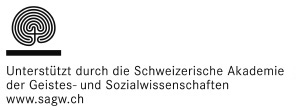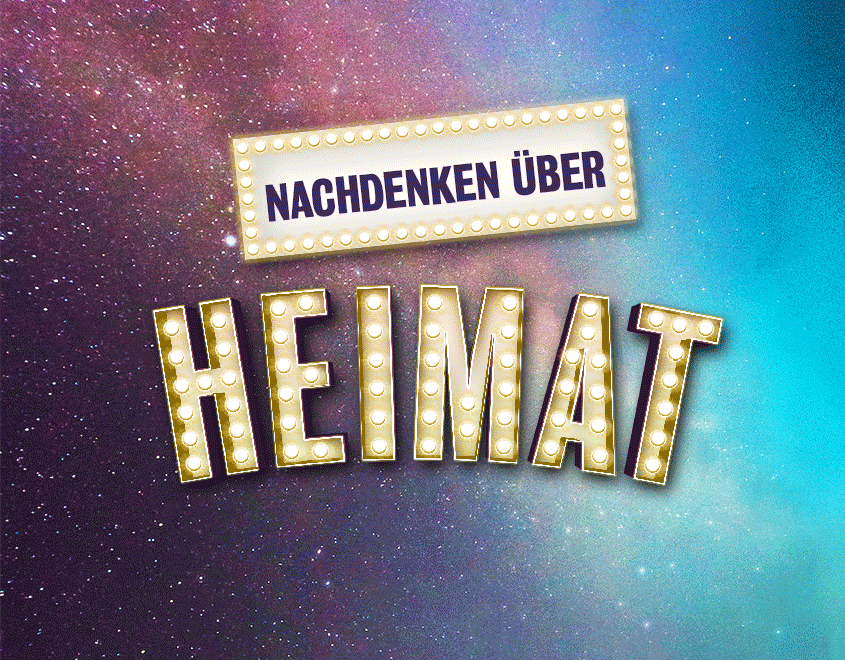Wenn man die erstaunlich geringe empirisch-psychogische Forschung über Heimat rekonstruiert, findet sich als eine der ersten eine Schweizer Studie: Gemeint ist nicht die historisch-psychopathologische Beschreibung der Nostalgia, der „Heimwehkrankheit“ Schweizer Söldner, sondern eine kleine, 1951 von Annemarie Weil und Jean Piaget in der Zeitschrift für Sozialpsychologie veröffentlichte Studie, in der Schweizer Kinder danach gefragt wurden, was für sie Heimat ist. Warum für sie die Schweiz, Italien oder Deutschland Heimat ist und was, ihrer Meinung nach, andere Kinder zu dieser Frage sagen würden. Das Ergebnis dieser Studie – die in Piagets entwicklungspsychologischem Stufenmodell am Übergang vom egozentrischen zum formalen Denken angesiedelt ist- ist deutlich: Heimat ist anfangs ein sehr „egozentrisches“ Konzept: jüngere Kinder begründen die Heimatlichkeit der Schweiz damit, dass da ihre Mama wohnt, sie da die meisten Leute kennen oder ihnen die Schokolade am besten schmeckt. Bei der Frage ob sie Genfer oder Schweizer sind, geraten sie in Verlegenheit (da sie diese Heimatbezüge noch nicht kategorial über- und unterordnen können). Wenn sie gefragt werden, was ein kleiner Engländer oder Deutscher wohl sagen würde, sind sie fest überzeugt und bleiben auch bei Nachfragen des Versuchsleiters dabei, dass auch für diese die Schweiz das beste Land sein müsse und stolpern dann allenfalls über die Begründung. Liess (und lässt) sich mit der Schweizer Schokolade noch ganz gut argumentieren, funktionierte das mit der/ihrer Schweizer Mama irgendwie nicht so richtig: Mögen andere Kinder die Schweiz auch deshalb, weil meine Mama da wohnt? Aber erst ältere Kinder, (die den Übergang vom egozentrischen, auf die eigene Bedürfnisse gerichteten Denken zum formalen Denken, also dem Denken in Kategorien und Konzepten geschafft haben) wissen, dass für ausländische Kinder ihr jeweiliges Land wohl genauso Heimat ist, wie für einen kleinen Schweizer die Schweiz. Auch diese Studie müsste heute allerdings repliziert werden. Die Selbstverständlichkeiten der relativ geschlossenen, sesshaften und monokulturellen Gesellschaft, in der alle wissen, woher sie kommen und wohin sie gehören- kommt auch Kindern schon abhanden. Was von Stefan Hormuth, einem deutschen Sozialpsychologen 1989 an Diplomatenkindern noch unter eher psychopathologischen Aspekten diskutiert wurde, den Einfluss, den permanenten Orts- und Kultur-Wechsel, die Zugehörigkeit zu mehreren Orten, zwischen denen mitunter Welten liegen, auf die kindliche Entwicklung und ihr Selbstkonzept haben, wird heute zur Normalerfahrung von Kindern, deren Leben von Mobilität und von Migration geprägt ist. Nicht immer ihrer eigenen, aber der Tatsache, dass um sie herum Menschen verschwinden, andere zuziehen, mit neuen, anderen Verhaltensweisen, Gebräuchen, Sprachen ihre Welt –bereichern oder bedrohen- aber doch immer auch relativieren. Aus der Migrationsforschung weiß man, dass das von Kindern als ganz normal erfahren werden kann, sie mit Heimatfragmenten operieren können, mehrere Heimaten ihr eigen nennen, eventuell Heimat als Ortsbestimmung verweigern oder ganz traditionell das als Heimat bezeichnen, worin sie eben (gerade) aufwachsen und leben.
Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass es in Mobilität und Veränderung einen sozial sicheren Ort gibt, Kinder verlässliche Zugehörigkeit, Vertrautheit und Einbindung erfahren haben, zuerst in der Familie, aber auch darüber hinaus: einen sozialen Zusammenhang, zu dem sie und in den sie hineingehören. Tragischer als Ortswechsel, die Kinder oft erstaunlich gut bewältigen, sind für sie die Trennungen von wichtigen Bezugspersonen (dazu gehören auch andere Kinder und Tiere) oder die Erfahrung von Nicht-Zugehörigkeit, Ausgrenzung und Diskriminierung. Heimat ist also noch mehr ein sozialer Zusammenhang als ein Ort bzw. genau genommen ein Ort, an dem dieser soziale Zusammenhang existiert, der anders als die von Marc Augé beschriebenen anonymen oder „Nicht-Orte“ soziale Zugehörigkeit und damit Identität stiftet. Die egozentrische Begründung der Kinder in der Weil/Piaget-Studie lässt uns eigentlich etwas erkennen über das soziale Wesen Mensch: Heimat sind ihm Orte, an denen er (viele/die meisten) andere Menschen kennt und Bindungen eingegangen ist.
Die Kulturanthropologin Ina Maria Greverus hat das noch weiter ausdifferenziert: Heimat ist Ort von Kennen-, Gekannt- und Anerkannt sein. Kennen ist auf einer oberflächlichen Ebene eine einfache Zuordnungsleistung: habe ich schon gesehen, kenne ich. Je länger ich an einem Ort lebe, umso mehr Leute kenne ich- zunächst nur vom Sehen. So wie ich schnell kategorisiert werde als fremd oder vertraut, kategorisiere ich andere Menschen. Kennen heißt aber weiter auch etwas über andere Menschen wissen, ihre Besonderheiten, ihre Erwartungen an Kommunikation, Regeln im Umgang mit Ihnen, vielleicht sogar ihre persönlichen Geschichten. Gekannt werden heißt umgekehrt, auch andere wissen wenigstens partiell, wer und wie ich bin, bzw. wie ich „zu nehmen“ bin, sie erkennen etwas von mir und ich gebe mich zu erkennen. Wir unterscheiden zwischen verbindlichen und unverbindlichen Beziehungen. Heimat ist ein Ort von Verbindlichkeit. Psychologisch gesehen ist das zunächst einmal eine kognitive „Sparmaßnahme“, dieses Kennen und Gekannt-werden, das Herausbilden von Gewohnheiten in Bezug auf Andere, auch von „kulturellen“ Regeln, erspart uns das ständige Neu-Orientieren, Absichern, Beobachten, „auf der Hut sein“, dass das Leben in der Fremde eben auch anstrengend macht. In einer Studie über innerdeutsche Migration nach der Wende (Brähler u.a.) erhöhten sich bei (fast) allen Untersuchten nach einem Umzug die Werte für Depressivität und Ängstlichkeit. Sie sanken erst wieder, als die Leute im Fragebogen angeben konnten: Ich habe neue Freunde gefunden. Soziale Bindung gibt uns Verhaltens-Sicherheit. Wir vertrauen denen, die wir kennen. In ihren Grenzen, die wir auch einigermaßen kennen. Dieses Netz sozialer Beziehungen, in das wir mit unserer persönlichen Identität eingewebt werden bzw. uns einweben, braucht allerdings auch den Aspekt der Anerkennung. Eine Umgebung, in der alle alles über uns zu wissen meinen, ist keine Heimat, sondern eben „Die Hölle“. Ohne Anerkennung- nicht nur (aber auch) unserer Leistungen, vor allem aber unserer Person, inklusive unserer Bedürfnisse nach Nähe oder/und Distanz, ist Kennen und Gekannt-werden nichts als soziale Kontrolle. Insofern können Großstädte mitunter „heimatlicher“ sein als Dörfer. Anonymer allerdings auch.
Diese Ein-Bindung ist auch ein Ergebnis sozialen Handelns. Soziale Resonanz entsteht manchmal, aber selten auch spontan, häufiger ist sie das Ergebnis eines mühsamen, wiederholten, geübten Fein-Tunings: Beim Kurzpassspiel in einer Fußballmannschaft, genauso wie bei der Intonation in einem Chor oder in einer Ehe, ja selbst in der Abstimmung zwischen Kindern und Eltern. Bindung ist ein zwar biologisch angelegtes, aber auch gelerntes bzw. eingeübtes Muster. Die euphorisierende Erfahrung von Schwingung- das heißt von weitgehender oder sogar völliger Übereinstimmung mit anderen kann vielleicht kurzfristig durch Musik, Drogen oder nationalistische Propaganda auch von außen indiziert werden; im Alltag ist es aber eher „stetiges Bemühen“ das, oft erst über längere Zeiträume zum Verschwinden der Grenzen zwischen ich und anderen und damit zum Gefühl von Heimat führt. Oder wie es Freud – wie immer scharfzüngig- als symbiotisches (und damit auch irgendwie unerwachsenes) Erleben charakterisieren würde.
Eine erwachsene Form von Heimat überwindet nicht nur die egozentrische Perspektive des kleinen Kindes, sondern in gewissem Maß auch den Wunsch nach symbiotischer Verschmelzung. Sie geht von der Erfahrung aus, dass Gemeinschaft kein bloß naturgegebener Zusammenhang ist, sondern aus gelingender Kooperation von unterschiedlichen Individuen mit partiell divergierenden Interessen, aber immer auch gemeinsamen Zielen resultiert. Heimat als gemeinschaftlicher Raum, als (sozio)kultureller Raum, auch als Raum politischer Gestaltung geht davon aus, dass unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ansichten sich auf etwas einigen müssen und zwar so, dass die Interessen möglichst aller Gruppen (außer denen, die die Gemeinschaft aufkündigen oder zerstören wollen) wenigstens partiell berücksichtigt werden. Permanente Privilegierung und Interessendurchsetzung einer oder weniger Gruppen auf Kosten anderer zerstört Heimat für alle, auch für die Privilegierten. Insofern ist Heimat weniger, als meistens proklamiert, eine Gefühlsgemeinschaft, sondern eher eine Verantwortungsgemeinschaft. Verantwortung hat auch der Nicht-Integrierte: sich um Zugang zu bemühen, Regeln zu erkennen, zu kommunizieren, Interessen zu verhandeln, zu partizipieren. Ob ihm Integration gelingt, liegt aber auch in der Verantwortung der Schon-Integrierten.
Fassen wir zusammen: Heimat aus sozial- und entwicklungspsychologischer Perspektive ist kein Fakt an sich, sondern etwas, das sich aus den Beziehung von Subjekten zu ihrer sozialen Umgebung ergibt. Es ist eine Beziehung die auf Bindung beruht, sich durch verbindliche Beziehungen, durch Verantwortungsübernahme für und Mitgestaltung des gemeinsamen sozialen Raums auszeichnet, das Diversität aushält und manchmal sogar befördert. Kennen, Gekannt und Anerkannt-werden ist Voraussetzung von Heimat. Eine andere ist die Überwindung von egozentrischem Denken und symbiotischen Phantasien. Die Heimat als sozialer Raum ist nicht unabhängig von Orten, sondern ist die gerechte Gestaltung des Sozialen unter den Bedingungen konkreter Orte. Damit ist sie auch- nach wie vor- eine Utopie.
Literatur
Piaget, J. Weil, AM (1951) The development in children of the idea of the homeland. International Social Science Bulletin, Jg.3, 561-578
Greverus, Ina-Maria (1979) Auf der Suche nach Heimat. München: Beck
Hormuth, Stefan(1989) Ortswechsel als Gelegenheit zur Änderung des Selbst. Diss. Heidelberg
Auge, Marc (1994) Orte und Nicht-Orte. Vorüberlegungen zu einer Ethnologie der Einsamkeit. Frankfurt, Fischer
Mitzscherlich, Beate (2000) Heimat ist etwas, was ich mache. Herbolzheim, Centaurus
Bloch, Ernst (1967). Das Prinzip Hoffnung. Frankfurt, Suhrkamp