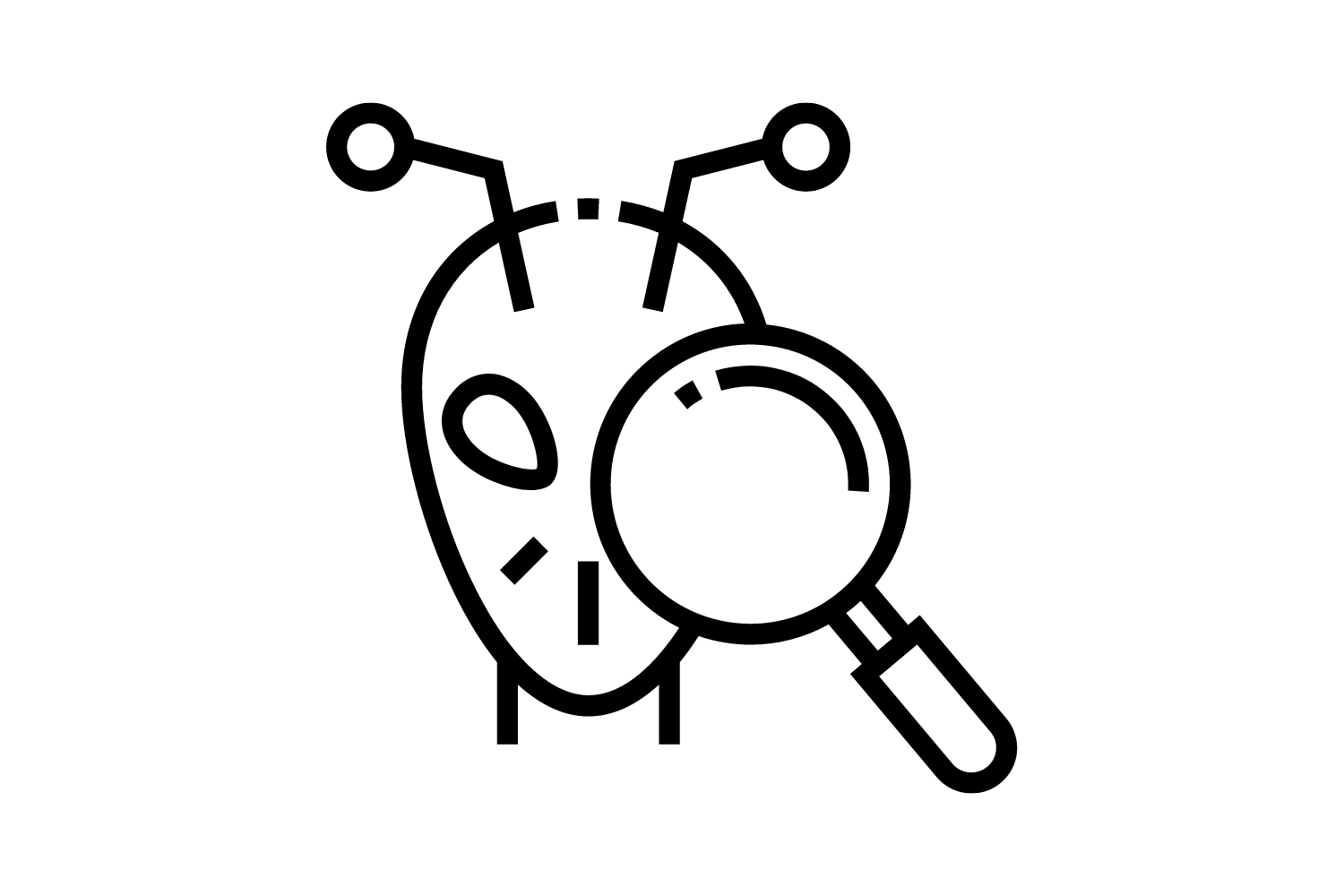Diese Frage kann durchaus in unserem Alltag auftauchen, und zu lebendigen Diskussionen führen – beispielweise nachdem man im Kino einen Science Fiction Film gesehen hat, oder wenn man in einer warmen Sommernacht in Gedanken versunken gen Himmel schaut, um die Sterne zu betrachten.
Die Intuitionen gehen bei dieser Frage in beide Richtungen. Einige denken, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass wir Erdenbewohner einen solch einzigartigen Status haben könnten, allein im Universum zu sein. Andere denken, dass die Entstehung von Leben so unwahrscheinlich ist, dass es ebenfalls unwahrscheinlich ist, dass es in unserem Universum in Hülle und Fülle vorkommen soll.
Die Frage ob es ausserirdisches Leben gibt – oder gar geben kann – ist bis anhin noch nicht klar mit „ja“ oder „nein“ beantwortet worden. Eine Schwierigkeit mit der Beantwortung dieser Frage liegt in der Frage an sich: Was ist es denn eigentlich nachdem wir suchen; was ist Leben?
Das Problem der Definition
Als ob wir nicht bereits genug Fragen hätten, können wir uns nun noch zusätzlich wundern: Wer ist für die Beantwortung der Frage „Was ist Leben?“ zuständig? Sind es die Biologinnen und Biologen, oder gar Philosophinnen und Philosophen? Oder eine Kreuzung: Philosophinnen und Philosophen der Biologie?
In ihrem Essay „Life Without Definitions“ schreibt Carol E. Cleland, eine Philosophin der Biologie, dass eine Definition von Leben eine empirisch adäquate Theorie voraussetzt. Der Definition an sich gegenüber ist sie aber generell negativ eingestellt, da eine solche uns lediglich den Wortgebrauch liefere, wir aber an einer Darstellung der Realität interessiert sind (die zwei sind nicht immer dasselbe). Laut Cleland müssen wir aufpassen, dass wir mit einer Definition nicht irregeleitet werden, da wir unsere Suche bereits zu Beginn einschränken. Ihr Beispiel um dies zu illustrieren ist die Definition von Wasser von Antoine Lavoisier im achtzehnten Jahrhundert als etwas „nasses, durchsichtiges, geschmackloses und gut lösliches“. Nach Cleland hilft uns diese Definition nicht, Wasser von Dingen zu trennen die nicht Wasser sind. „Salzwasser ist aber nicht geschmacklos“, wäre beispielsweise eine Entgegnung. Wenn man eine Definition einfach stipuliert, dann findet man oft Gegenbeispiele.
Keine Definition sondern eine wissenschaftliche Theorie
Ein weiteres Beispiel vom Philosophen John Locke, welches Cleland einbringt, dreht sich um die Frage, ob Fledermäuse Vögel sind oder nicht. Die damaligen Definitionen von Fledermäusen und Vögeln hätte beide Ergebnisse zugelassen – auf einer rein sprachlichen (oder definitorischen) Ebene, gäbe es keine klare Antwort. Wissenschaftliche Untersuchungen haben dann jedoch gezeigt, dass Fledermäuse den Säugetieren ähnlicher sind als den Vögeln. Bei der Suche nach Leben sollte man, so Cleland, ähnlich vorgehen. Wir müssen empirisch schauen, was Menschen, Bäume, Insekten, Schimmelpilze, Algen (usw.) gemeinsam haben, und so finden wir vielleicht eine essenzielle Eigenschaft von Leben, und somit was Leben ausmacht. So bringt die Philosophin der Biologie Kritik an der Methode der Definition des Lebens an: Wir brauchen also eine Theorie von Leben, nicht eine Definition. Hierin erkennt man philosophische Überlegungen zu einem eigentlich biologischen Thema.