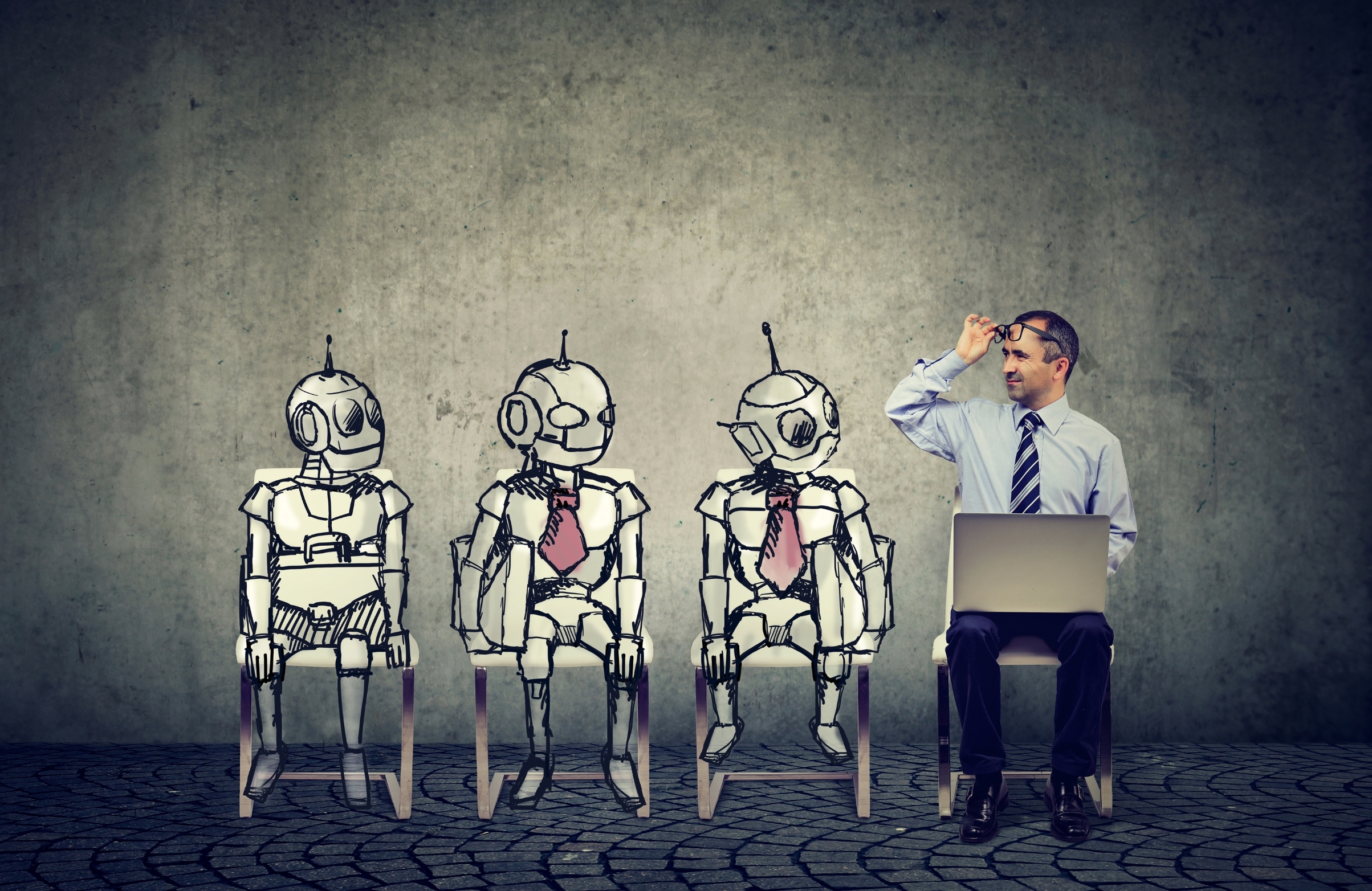Frankfurt, Bremen, Hamburg, Lübeck sind groß und glänzend, ihre Wirkung auf den Wohlstand von Deutschland gar nicht zu berechnen: Würden sie aber wohl bleiben was sie sind, wenn sie ihre eigene Souveränität verlieren und irgendeinem großen deutschen Reiche als Provinzialstädte einverleibt werden sollten?
Ich habe Ursache daran zu zweifeln.
-
Johann W. v. Goethe
Der Marktplatz der Ideen, ein trostloser Ort
Es ist kein Geheimnis, in der Politik gibt es keinen Raum mehr für große Würfe. Es wird auf Sicht gefahren. Es gilt das Primat der Realpolitik. Natürlich gibt es sie noch, die großen Ideen. Wissenschaftler, Philosophen und Aktivisten haben nie aufgehört, große Skizzen an die Wand zu werfen, Blueprints für eine neue, eine bessere, eine sozialere, eine umweltbewusstere, eine freiere und eine gerechte Welt. Die besten dieser Entwürfe finden ihren Weg auch heute noch in den akademischen und öffentlichen Diskurs, auf den Marktplatz der Ideen. Hier tummeln sie sich die sozialistischen, anarchistischen, neoliberalen, libertären, sozialdemokratischen, techno-visionären und umwelt-revolutionären Utopien. Auch wenn die skizzierten Visionen eines besseren Miteinanders inhaltlich nicht diverser sein könnten, so einigt sie doch eins: sie finden keine Abnehmer mehr. Der Marktplatz der Ideen ist ein trostloser Ort geworden. Die Visionäre – Philosophen, Wissenschaftler und Aktivisten – sie streiten noch miteinander, aber es hört ihnen niemand mehr zu. Die Bevölkerung ist realistisch geworden. Das Ende der Geschichte wurde eingeläutet. Wenn die Visionäre an einem Strang zögen, so könnten sie vielleicht noch etwas bewegen. Aber man ist sich nicht einig. Man strebt auseinander. In allen wesentlichen politischen Fragen besteht – auch zwischen wohlwollenden, vernünftigen Vor- und Mitdenkern – ein tiefer Dissens. Im Politischen spiegelt sich der Dissens im Parlament wieder. Das Resultat: Kompromisse statt Konsense. Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück.
Überlappende Unzufriedenheit, wer träumt noch von Überlappenden Konsensen? Wenn die Vektoren der politischen Ideen in verschiedene Himmelsrichtungen zeigen, degeneriert Politik zum Tauziehen. Die Bevölkerung hat inzwischen bemerkt, dass von der Politik nur noch Reförmchen zu erwarten sind. Dass nur noch verwaltet wird. Politik als Besitzstandswahrung. So eine Politik kann nicht mehr begeistern. Politikverdrossenheit ist die Konsequenz. Man bezeichnet so eine politische Situation vielleicht am besten als einen demokratischen Modus Vivendi. Man hat sich arrangiert und das sogar in doppelter Hinsicht, hat man sich doch auch längst damit arrangiert, sich arrangiert zu haben. Es geht nicht mehr um Gerechtigkeit, es geht um Frieden, darum gut auszukommen.
Bye Bye, Utopia? Wer über den politischen Stillstand, die politische Wohlstandsverwaltung, das Fahren auf Sicht klagt, muss sich natürlich fragen lassen, ob er nicht vielleicht zu viel von der Welt erwartet. Unbestreitbar gehört der demokratische Modus Vivendi, über dessen politische Tristesse hier geklagt wird, zu den besten politischen Gebilden in der Geschichte der Menschheit. Nie gab es gesellschaftlich größere Inklusion, nie waren die Rechte von Männern und Frauen besser geschützt, nie war für die Versorgung der Gesellschaft besser gesorgt, nie konnten wir uns mit so wenig Arbeit so viel leisten. Der Kritiker klagt insofern auf hohem – nein, auf höchstem – Niveau!
Auch wenn all dies eingestanden werden muss, ja sogar gerne eingestanden wird, so darf man doch fragen, ob es nicht noch besser geht. Denn unbestritten muss doch auch sein, dass unsere Zeit ihre Visionäre, ihr politisches Kreativpotential weitgehend ungenutzt lässt. Auch scheint es nicht ganz unplausibel zu sein, dass unter all den Utopia-Blueprints und den radikalen Reformvorschlägen für Teilsysteme unseres Sozialstaats einige wenige unser soziales Miteinander vielleicht entscheidend verbessern könnten. Die Frage, die ich hier stellen möchte lautet deshalb: Müssen sich moderne, pluralistische Gesellschaften mit einem politischen Modus Vivendi zufriedengeben oder geht es nicht doch ‚besser‘? Anders formuliert: Ist eine realistische Utopie möglich oder müssen wir uns zufrieden geben mit einem politischen Modus Vivendi? Dies ist dann auch die Frage, die dieses Essay zu beantworten versucht.
Zur Impotenz visionärer Philosophie
Wenn wir die Hauptfrage des Essays – ist eine realistische Utopie möglich – beantworten wollen, scheint es zunächst einmal geboten, sich mit den philosophischen Antwortskizzen vertraut zu machen. Eine Option bestünde insofern darin, verschiedene Utopien und Gerechtigkeitskonzeptionen, die Philosophinnen und Philosophen seit der Achsenzeit produziert haben, zu diskutieren. Dies erscheint auf den zweiten Blick jedoch nicht nur mühsam und wenig unterhaltsam, sondern – und darauf kommt es an – auch wenig zielführend. Anstatt sich inhaltlich mit den Konzeptionen auseinanderzusetzen, möchte ich hier die Aufmerksamkeit sozusagen auf die Geschäftspraxis von Utopieproduktion lenken. Wenn Philosophen sich daranmachen, realistische Utopien zu entwickeln und so die Gesellschaft voranzubringen, lassen sie meines Erachtens von so etwas wie dem Standardmodell für Philosophische Utopieproduktion leiten:
-
Finde durch Reflektion die Spielregeln X einer gerechten Gesellschaft.
-
Überzeuge alle wohlwollenden, vernünftigen Bürger im Diskurs von X.
-
Implementiere X.
Meines Erachtens ist das Standardmodell für Philosophische Utopieproduktion instruktiv, weil es uns erlaubt, zwei problematische Hintergrundprämissen politisch philosophischer Theoriebildung in den Blick zu bekommen. Sowohl die erste als auch die zweite Maxime sind aus ganz unterschiedlichen Gründen problematisch. Zum einen fördert das Modell zu Tage, dass die Politische Philosophie ein ganz und gar überholtes Verständnis von den Erkenntnismöglichkeiten von Armsessel-Reflektion hat. Zum anderen macht das Modell deutlich, dass der Philosophie ein vollkommen inadäquates Verständnis von der Zugkraft von Argumenten zu Grunde liegt und – eng damit zusammenhängend – ein geradezu naives Verständnis von gesellschaftlichen Lernprozessen besitzt. Im Folgenden möchte ich die Probleme des Standardmodells unter den Begriffen ‚Erkennen‘ und ‚Überzeugen‘ ein wenig weiter ausleuchten.
‚Erkennen‘. Gerade in der deutschen Philosophie scheint der Glaube weit verbreitet, dass es vollkommen ausreicht, aus dem Fenster zu schauen, um die Welt zu erkennen. Es ist nicht nötig in die Welt zu gehen und sich mit den Spezifika von Problemen auseinanderzusetzen, Daten zu sammeln und auszuwerten oder experimentell Fragen von Ursache und Wirkung nachzugehen. Alles, was wirklich wichtig ist, lässt sich in der Wärme der eigenen Stube vom sprichwörtlichen Lehnsessel erkennen. Wohin solch eine Anmaßung von Wissen führen kann, hat uns im letzten Jahrhundert der Sozialismus eindrücklich vorgeführt. Die sozialistischen Vordenker waren nicht nur davon überzeugt, dass die sozialwissenschaftlichen Theorien hinter ihren ökonomischen Modellen wahr sind, sondern auch davon, dass die sozialistische Utopie uneingeschränkt wünschenswert ist. Ferner hielt man die sozialistische Lehre für so selbstevident, dass Kritik an dieser bereits als sicherer Ausweis von Böswilligkeit verstanden und entsprechend geahndet wurde. Es soll dabei nicht unerwähnt bleiben, dass es in der Geschichte der sozialistischen Theoriebildung durchaus Denker wie John Stuart Mill, aber auch Praktiker wie Owen, gab, die einen vorsichtigeren, tastenden auf den Prinzipien von trial-and-error beruhenden Sozialismus vertreten haben. Diese Stimmen konnten sich jedoch nicht durchsetzen, gegen diejenigen, die meinten durch Armsessel-Reflexion den Lauf der Geschichte, die Prinzipien der Ökonomie und die Wahrheit in normativen Fragen erblickt zu haben. Es soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass dieser vermessene Erkenntnisanspruch von Armsessel-Reflexion in keiner Weise eine Eigenheit von sozialistischem Denken ist, man denke nur an die Utopien von Platon oder die des Theologen Thomas Morus. Empiriefeindlichkeit und eine generelle Fehleinschätzung der Leistungsfähigkeit von simplen Modellen sind dabei weder Eigenheiten sozialistischer oder philosophischer Reflexion. In jüngster Zeit haben sowohl die verfehlten ökonomischen Reformpakete in Russland – Stichwort: Shock-Doktrin – als auch die verfehlten ökonomischen Liberalisierungen in Afghanistan und im Irak gezeigt, dass die Fehleinschätzung der Leistungsfähigkeit von abstrakten Modellen kein Fehler irgendeiner speziellen Ideologie ist.
‚Überzeugen‘. Seit der Antike ist die Philosophie ein Begründungsspiel. Eine der fundamentalen – aber meist unausgesprochenen – Prämissen dieses Spiels lautet, dass sich das bessere Argument im Diskurs unter wohlwollenden und vernünftigen Menschen für gewöhnlich durchsetzt. Im Hintergrund, so mag man spekulieren, steht hier wohl noch die Idee, dass das Gute und Wahre selbstevident ist und wenn erkannt, sich in gewisser Weise selbst enthüllt. Habermas hat diese Gründungsidee der Philosophie im Diktum ‚vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments‘ in gewisser Weise ein modernes Gewandt verliehen.
Die Zugkraft vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments muss indes entschieden in Frage gestellt werden. Wenn sich eine Gruppe von wohlmeinenden und vernünftigen Bürgern, Wissenschaftler, Philosophen – oder wie man heute gerne sagt: Experten – sich etwa zum Thema Gerechtigkeit zusammensetzt, so steht am Ende nicht Konsens sondern Dissens. Dies lehrt nicht nur die Alltagserfahrung, sondern ist mithin auch das in zahllosen Essays und Büchern geronnene Resultat eines über hunderte Generationen andauernden Diskurses innerhalb der Philosophie und angrenzender Felder. An dieser Stelle ist es nicht möglich in nötiger Schärfe darzustellen, weshalb selbst Diskurse, die sich an Habermas regulatives Diskursideale halten, ihr Versprechen nicht einhalten können. In der Dissertation zeige ich, dass es schwerwiegende epistemische, psychologische und transaktionskostentheoretische Faktoren gibt, die eine korrekte Evaluation von neuen Ideen innerhalb von Diskursen erschweren und meist sogar unmöglich machen.
Wie angedeutet, besitzt die Philosophie nicht nur ein ganz inadäquates Bild von der Zugkraft von Argumenten, sondern auch von gesellschaftlichen Lernprozessen. Innovationen setzen sich generell nicht mittels von Trakten durch. Ein Gedankenexperiment mag dies verdeutlichen: Hätte Steve Jobs etwa alle heutigen iPhone Nutzer erst mittels eines Essays vom Nutzen und der Ästhetik des iPhones überzeugen müssen, bevor er die Erlaubnis bekommen hätte, seine Innovation in die Produktion zu geben, so würde heute niemand die Marke Apple mehr kennen. Doch davon in Kürze mehr.
Visionäre Impotenz, Diagnose und Behandlung
Das Ausgangsproblem, dem ich mich hier – und in der zu Grunde liegenden Dissertationsschrift –stelle, kann insofern wie folgt aktualisiert werden. Die modernen, demokratisch verfassten Staaten sind in einem Modus Vivendi gefangen und die einzige akademische Disziplin, deren Aufgabe es ist, nach realistischen Utopien zu fahnden, produziert am Problem vorbei.
Wenn unser Ziel ist, eine realistische Utopie zu formulieren, eine Gesellschaftskonzeption, die trotz unserer Meinungsverschiedenheiten realisierbar ist, sollten wir uns zuerst einmal damit beschäftigen, auf welchem Weg moderne Gesellschaften realistischer Weise aus dem Modus Vivendi in Richtung Utopie bewegen könnten. Das Realismus-Kriterium sagt dabei dreierlei: Wir müssen einen Weg zur Utopie zeichnen, der (a) mit einem tiefen Dissens in normativen und sozioökonomischen Fragen rechnet, der (b) die Limitierungen von Armsessel-Reflexion und c) der Kraftlosigkeit des besseren Arguments Rechnung trägt. Im Weiteren soll es deshalb zuerst darum gehen, dass Standmodell philosophischer Utopieproduktion im Hinblick auf die Unterpunkte (b) und (c) zu aktualisieren. Anders formuliert: Wir wollen das Standard-Modell zunächst im Hinblick auf ‚Erkennen‘ und ‚Überzeugen‘ aktualisieren.
Erkennen‘. Utopische Gesellschaftskonzeptionen sind zuerst einmal Innovationen. Nun ist es so, dass Experten regelmäßig daran scheitern den Wert – selbst von relativ einfachen – Innovationen richtig einzuschätzen. Die Innovationsforscher Licuanan und Kollegen stellen etwa folgende Liste von prominenten Fehleinschätzungen bereit:
-
When J. K. Rowling wrote her first book in the Harry Potter series, it was rejected by a long list of publishers who saw little appeal, and little originality, in the idea of a school for wizards.
-
When executives at International Business Machines (IBM) were presented with the first personal computers, they viewed personal computers as toys having no real implications for IBM’s key product at the time — mainframe computers.
-
When the United States military was first presented with the Wright Brothers flying machine, they failed to anticipate the marked impact airplanes would have on our world.
Diese Liste kann beliebig erweitert werden und jedem Leser werden ohne Zweifel andere prominente Beispiele in den Sinn kommen. Etwa die Voraussage des Ökonomie-Nobelpreis-Trägers und Star-Kolumnisten Paul Krugman, der noch 1998 der Auffassung war, dass das Internet auf die Entwicklung der Ökonomie in etwa so einen großen Einfluss haben würde wie die Fax-Maschine. Wenn nun bereits die Experten bei IBM Probleme haben, eine Innovation wie den Heimcomputer auch nur in Ansätzen korrekt zu evaluieren, wie soll es Philosophen, Ökonomen und Politikwissenschaftlern dann möglich sein, im Vorwege komplexe Innovationen wie Utopien oder radikale Neuerungen einzelner Sozialsysteme korrekt zu evaluieren? Auch wenn es Philosophen seit Platon beleidigt, dem Menschen bleibt nichts anderes übrig als seine Vorstellungen, Konzepte, Produkte, Gerechtigkeitskonzeptionen und politischen Institutionen in einem Trial-and-Error-Prozess zu prüfen. Letztlich gibt es der Sentenz Sophokles wenig hinzuzufügen: [O]ne must learn by doing the thing, for though you think you know it – you have no certainty, until you try.
‚Überzeugen’. In der Philosophie machen wir uns wenig Gedanken darüber, wie Überzeugungsarbeit funktioniert. Aus irgendeinem Grund sitzen wir Philosophen der Überzeugung auf, dass die einzig ehrliche Weise zu überzeugen darin besteht, einen 700-seitigen Aufsatz zu schreiben. (Vermutlich ist dies im philosophischen Wissensbegriff begründet). Es ist sogar so dass wir die einzige Schule, die sich damit beschäftigt hat, wie Überzeugungswandel praktisch funktioniert, seit 2500 Jahren in jedem Einführungsseminar Philosophie diffamieren. Die Rede ist natürlich von den Sophisten. Es ist nun einfach einzusehen, dass Überzeugungen normalerweise nicht durch die Lektüre von Traktaten gewonnen wird. Bereits um 1922 haben Ökonomen gezeigt, dass der Sozialismus aufgrund der Unmöglichkeit von Wirtschaftsrechnung niemals den versprochenen Reichtum für alle produzieren kann und aus inner-ökonomischen, i.e. nicht etwa aus psychologischen Gründen, dysfunktional ist. Diese Einsichten haben aber weder Lenin oder Mao, noch die sozialistischen Fahnenträger en Groß überzeugen können, dass zumindest Sozialismen, die auf Zentralplanung setzen, zum Scheitern verurteilt sind. Was die Menschen davon überzeugt hat, dass der Sozialismus Marx’scher Couleur nicht erstrebenswert ist, waren die Erfahrung mit dem realexistierenden Sozialismus und vor allem mit dessen Zusammenbruch auf weiter Front. Was diese Anekdote – und um mehr handelt es sich nicht – nahelegt, ist, dass das Sprichwort ‚alle Theorie ist grau‘ tatsächlich für die meisten Menschen gilt. Auch legt diese Anekdote nahe, dass sich Menschen bei der Evaluation einer Innovation wenig von eben jenen 700-seitigen Essays leiten lassen, sondern von ihren konkreten Erfahrungen oder den Erfahrungen anderer. Diese ersten, noch sehr tentativen Einsichten werden jedoch von einer sehr breiten empirischen Literatur gestützt, der Innovationsdiffusionstheorie.
Im Folgenden werde ich einige für unsere Zwecke wesentlichen Einsichten dieser Literatur vorstellen. Die Innovationsdiffusionstheorie legt nahe, dass eine Invention nur große Teile der Gesellschaft überzeugen kann, wenn ihr (a) die Möglichkeit gegeben wird, die Form einer Innovation anzunehmen und ihr (b) ermöglicht wird, sich in einem Prozess sequentieller Überzeugung zu verbreiten. Ich möchte hier kurz auf beide Bedingungen eingehen und die Unterscheidung zwischen Invention und Innovation motivieren. Eine Invention verhält sich zur Innovation wie das Backrezept zum Kuchen, wie der Businessplan zum Unternehmen oder Das Kommunistische Manifest zum real existierenden Sozialismus. Eine Invention verwandelt sich also im Zuge ihrer physischen Implementation in eine Innovation. Aus einer epistemischen Warte, gibt es dabei notwendig eine Wissenslücke zwischen Invention und Innovation. Dies bedeutet, dass generell schwierig ist auf Grundlage einer Invention (i.e. einer Projektskizze) korrekt über den Wert der resultierenden Innovation zu urteilen. Firmen wie Apple – so liest man – verzichten deshalb auch auf weitgehend auf focus groups, um im Vorhinein zu ermitteln, ob ein zukünftiges Produkt auf das Interesse der Kunden stößt oder nicht. Diese Einsicht – so hat bereits Machiavelli erkannt – hat auch wesentliche Politische Konsequenzen:
Man muss sich nämlich darüber im Klaren sein, dass es kein schwierigeres Wagnis, keinen zweifelhafteren Erfolg und keinen gefährlicheren Versuch gibt als [...] eine neue Ordnung einzuführen; denn jeder Neuerer hat all die zu Feinden, die von der alten Ordnung Vorteile hatten, und er hat an denen nur laue Verteidiger, die sich von der neuen Ordnung Vorteile erhoffen. Diese Lauheit kommt [...] teils von dem Misstrauen der Menschen, die wirkliches Zutrauen zu den neuen Verhältnissen erst haben, wenn sie von deren Dauerhaftigkeit durch Erfahrung überzeugt worden sind. (Emphase hinzugefügt).
Dabei gilt zu beachten, dass selbst nachdem eine Invention in eine Innovation transformiert wurde, ist es oft schwierig den Nutzen – oder auch nur die Eigenschaften – einer Innovation klar abzusehen. Dies erklärt auch, warum eine Innovation im Normalfall erst einmal nur auf das Interesse einer kleinen Anzahl von überdurchschnittlich risikofreundlichen Personen, so genannten early adopters, trifft. Durch die Nutzung einer Innovation werden Stück für Stück immer mehr Eigenschaften der Innovation salient, so dass im Erfolgsfall im zweiten Schritt auch etwas weniger risikofreundliche Interessenten beginnen eine Innovation zu nutzen. Diesen Prozess nenne ich in erster Annäherung „Sequential Persuasion“. In der Dissertation verwende ich einigen Raum darauf diesen Prozess zu analysieren. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Inventionen mehr Chancen haben sich durchzusetzen, wenn sie sich als Innovationen in einem Prozess sequentieller Überzeugung durchsetzen können. Um den Punkt zu verdeutlichen: Nehmen wir an, es gäbe ein Zentralkomitee, das darüber entscheiden würde, welche Inventionen oder Innovationen auf den Markt kommen. In diesem Fall – so legt das Beispiel von Licuanan nahe – hätte weder Harry Potter die Herzen von Millionen Menschen gewinnen können, noch wäre das Zeitalter des PCs in den 90ern angebrochen. Selbiges gilt im Übrigen auch für die Wissenschaft. Wenn ein Zentralkomitee – sei es demokratisch legitimiert oder nicht – darüber entscheiden müsste, welche neuen Forschungsansätze verfolgt werden sollten und welche nicht, würde unser Wissenschaftsprozess zum Erliegen kommen. Dies ist keine Spekulation, sondern empirisch gut belegt, da mit Zentralplanung der Wissenschaft in der ehemaligen Sowjetunion experimentiert wurde. Letztlich haben wir in den letzten fünfzig Jahren eingesehen, dass es Wettbewerb braucht, damit die besseren Ideen sich durchsetzen können. Wir haben uns deshalb von Zentralplanung in Wirtschaft und Wissenschaft abgewendet. Die Frage, die meine Arbeit aufwirft, ist warum wir der Zentralplanung weiterhin im Politischen vertrauen. Kehren wir aber nun zurück zum Hauptstrang unserer Argumentation. Auf Grundlage unserer Bemerkungen zur Innovationsdiffusion lässt sich folgende allgemeine Maxime für Innovatoren aufstellen:
-
Skizziere eine Invention.
-
Verwandle die Invention in eine Innovation.
-
Überzeuge risiko-freundliche Interessenten von der Innovation.
-
Hoffe, dass die Innovation sich in einem Prozess ‚Sequentieller Überzeugung‘ durchsetzt.
Ein plausibleres Standardmodell für Utopieproduktion sollte sich meines Erachtens stärker an eben jener Maxime für Innovatoren orientieren. In Bezug auf die philosophische Utopieproduktion legt diese Ausführungen nahe, dass eine Utopische Skizze – verstanden als Invention – initial unter normalen Umständen niemals eine größere Gruppe an Menschen überzeugen wird können. Weiterhin, legt die Innnovationsdiffusionstheorie nahe, dass Utopieproduzenten sich stärker darauf konzentrieren sollten, Gesellschaftskonzepte oder gesellschaftliche Teilsysteme (z.B. Schulsysteme, Solidarformen, etc.) zu formulieren, die innerhalb großangelegter sozialer Experimente, z.B. innerhalb von semi-autonomer Freistädte oder in Sonderverwaltungszonen, getestet werden können
Polyzentrische Demokratie
In der Dissertation gehe ich der Frage nach, wie ein Staatswesen organisiert sein müsste, um Experimente mit neuen gesellschaftlichen Kooperationsformen zu ermöglichen. Aufbauend auf den Konzepten von Michael Polanyi, den Ökonomie-Nobelpreisträgern James Buchanan und Elinor Ostrom, skizziere ich ein institutionelles Gefüge, das verspricht, unseren gesellschaftlichen Dissens in normativen sowie sozio-ökonomischen Fragen in einen positiven sozialen Lernprozess zu transformieren. Dieses institutionelle Gefüge nenne ich ‚Polyzentrische Demokratie‘. Eine Polyzentrische Demokratie ist definiert als institutionelles Arrangement, das eine Vielzahl von Entscheidungszentren umfasst, die alle unabhängig agieren, aber gleichzeitig den demokratisch legitimierten Spielregeln institutioneller Konkurrenz unterliegen.
Die wesentlichen Funktionen einer Polyzentrischen Demokratie lassen sich dabei wie folgt umreißen:
-
Entdeckung neuer Optima. Da Konkurrenz ein Entdeckungsverfahren ist, sollte ein polyzentrisches politisches System kontinuierlich bessere Alternativen finden, das gesellschaftliche Leben zu organisieren.
-
Reduzierung seichter Dissense. Viele Dissense in der Politischen Philosophie basieren aller Wahrscheinlichkeit nach auf unterschiedlichen sozio-ökonomischen Hintergrundprämissen. In einem polyzentrischen System können mehr sozio-ökonomische Hypothesen getestet und falsifiziert werden als in unserem gegenwärtigen demokratischen System.
-
Entschärfung tiefer Dissense. Es ist darüber hinaus wahrscheinlich, dass nicht alle unsere Dissense auf unterschiedlichen sozio-ökonomischen Hintergrundprämissen beruhen. In einem polyzentrischen System können Menschen mit unterschiedlichen moralischen Einstellungen ihren Lebensentwürfen nachgehen.
An dieser Stelle sind vielleicht ein paar Worte zur Einordnung der Konzeption angebracht. Die Politische Philosophie begreift Dissens sowohl in normativen als auch instrumentellen Fragen vor allem als Problem. Dissens, so die Standardposition, ist dabei nicht nur ein philosophisches, sondern auch ein praktisches Problem, da Dissens die Stabilität gesellschaftlicher Kooperation gefährdet. Es kann dann auch nicht überraschen, dass Philosophen den allgegenwärtigen Dissens in normativen so wie in sozioökonomischen Fragen vor allem als Gefahr wahrnehmen. Ob eine Vielzahl von Perspektiven den Zielen der Gesellschaft abträglich oder zuträglich ist, hängt jedoch, so argumentiere ich in Anlehnung an Karl Popper, von den institutionellen Spielregeln ab. Eine wesentliche theoretische Umstellung, die im Konzept der Polyzentrischen Demokratie zu tragen kommt, ist dann, dass politischer Dissens nicht mehr primär als Problem, sondern als Ressource und Bedingung für den gesellschaftlichen Fortschritt verstanden wird. Während politische Kreativität in einer zentralisierten Demokratie unauflösbare Dissense erzeugt und zu ideologischen Pattsituationen führt, nutzt die Polyzentrische Demokratie eben jene Kreativität, um fortwährend bessere institutionelle Arrangements zu finden.
Im Sinne einer theoriegeschichtlichen Einordnung sollte zumindest auch erwähnt sein, dass es gewisse Überschneidungen des hier skizzierten gesellschaftlichen Idealbilds gibt mit den Entwürfen von großen, gegenwärtigen liberalen Theoretikern wie James M. Buchanan, Chandran Kukathas und Robert Nozick. Auch wenn es hier an der Oberfläche Überschneidungen gibt, so unterscheiden sich die Modelle dieser Denker doch stark vom Ideal der Polyzentrischen Demokratie sowohl institutionell als auch in ihrer normativen Ausrichtung.
Grundsätzlich gibt es eine Reihe von Möglichkeiten das Idealbild ‚Polyzentrische Demokratie‘ zu implementieren. Denkbar wäre etwa das Polyzentrische Ideal im Sinne eines Föderalstaates zu fassen. Eine wesentliche Komponente des Polyzentrischen Ideals besteht jedoch gerade darin, dass die Erprobung neuer Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens gesetzlich zugelassen ist und dass solche Sozialexperimente auch tatsächlich stattfinden. Da alle traditionellen Vorschläge ein polyzentrisches System zu implementieren, meines Erachtens zu radikal sind und nicht auf allgemeine Zustimmung hoffen können, konstruiere ich in der Arbeit einen neuen Ansatz, der auf mehr Zustimmung treffen könnte: Den Freistadt-Entwurf. Der Hauptgedanke dieses Ansatzes besteht darin, einige existierenden Städten mehr Selbstverwaltungsrechte einzuräumen (bzw. diese zurückzugeben, vgl. das einführende Goethe-Zitat) und darüber hinaus legislativen Raum für Sonderverwaltungs- bzw. Sonderwirtschaftszonen und ‚Start-Up Cities‘ zu schaffen. Solche Sonderverwaltungszonen können etwa dazu genutzt werden – teilweise ist dies auch bereits Praxis – um die ökonomische Entwicklung ‘anzukurbeln’ wie im Fall von Sonderwirtschaftszonen, um bessere Organisationsformen des Zusammenlebens zu finden, wie von Axel Honneth und John Stuart Mill vorgeschlagen oder um Raum zu schaffen für visionäre technologische Stadtplanungsvisionen wie etwa Google sie anstrebt. Der Freistadt-Ansatz hat gegenüber anderen denkbaren Implementierungsmöglichkeiten den großen Vorzug, dass er keine wesentlichen Änderungen der bestehenden staatlichen Ordnung voraussetzt.
Abschließen soll noch etwas zur normativen Fundierung der hier skizzierten Gesellschaftsordnung gesagt werden. Ziel der Politischen Philosophie ist es, Lösungen für Probleme zu erarbeiten, die im Interesse aller wohlmeinenden, vernünftigen gesellschaftlichen Fraktionen sind. In meiner Arbeit versuche ich deshalb zu plausibilisieren, dass aus Sicht aller wohlmeinenden Fraktionen – i.e. aus Sicht von Sozialdemokraten, Deliberativen Demokraten, Sozialisten (verschiedenster Couleur), Liberalen, Kommunitaristen, Libertären, Anarcho-Kapitalisten usw. – das institutionelle Gefüge Polyzentrische Demokratie in der Freistadt-Variante der monozentrischen Demokratie vorzuziehen ist. Dies bedeutet letztlich, dass alle politischen Fraktionen, wären sie über die Vor- und Nachteile von Polyzentrischer Demokratie und Modus Vivendi Demokratie informiert, die erstere der letzteren vorziehen würden. Einige der wesentlichen Vorteile und Funktionsweisen der Polyzentrischen Demokratie wurden in diesem Essay bereits ausgeführt, so dass an dieser Stelle auf die Wiedergabe der recht technischen Arguments verzichtet werden kann.
Dass so ein Ansatz tatsächlich von einem Überlappenden Konsens getragen werden könnte, hat sich gerade in den letzten Monaten auf unvorhergesehene Weise bestätigt. Axel Honneth hat in seiner Ende 2015 erschienen Monographie Die Idee des Sozialismus die auf John Stuart Mill zurückgehende Idee aufgegriffen, nach der sich revolutionäre gesellschaftliche Lebensentwürfe nur in ‚experiments of living‘ Bahn brechen können und dürfen. Damit plädieren erstmals nicht nur führende liberale Theoretiker, sondern auch kommunitaristisch-sozialistische Vordenker für eine Variante der Polyzentrischen Demokratie.