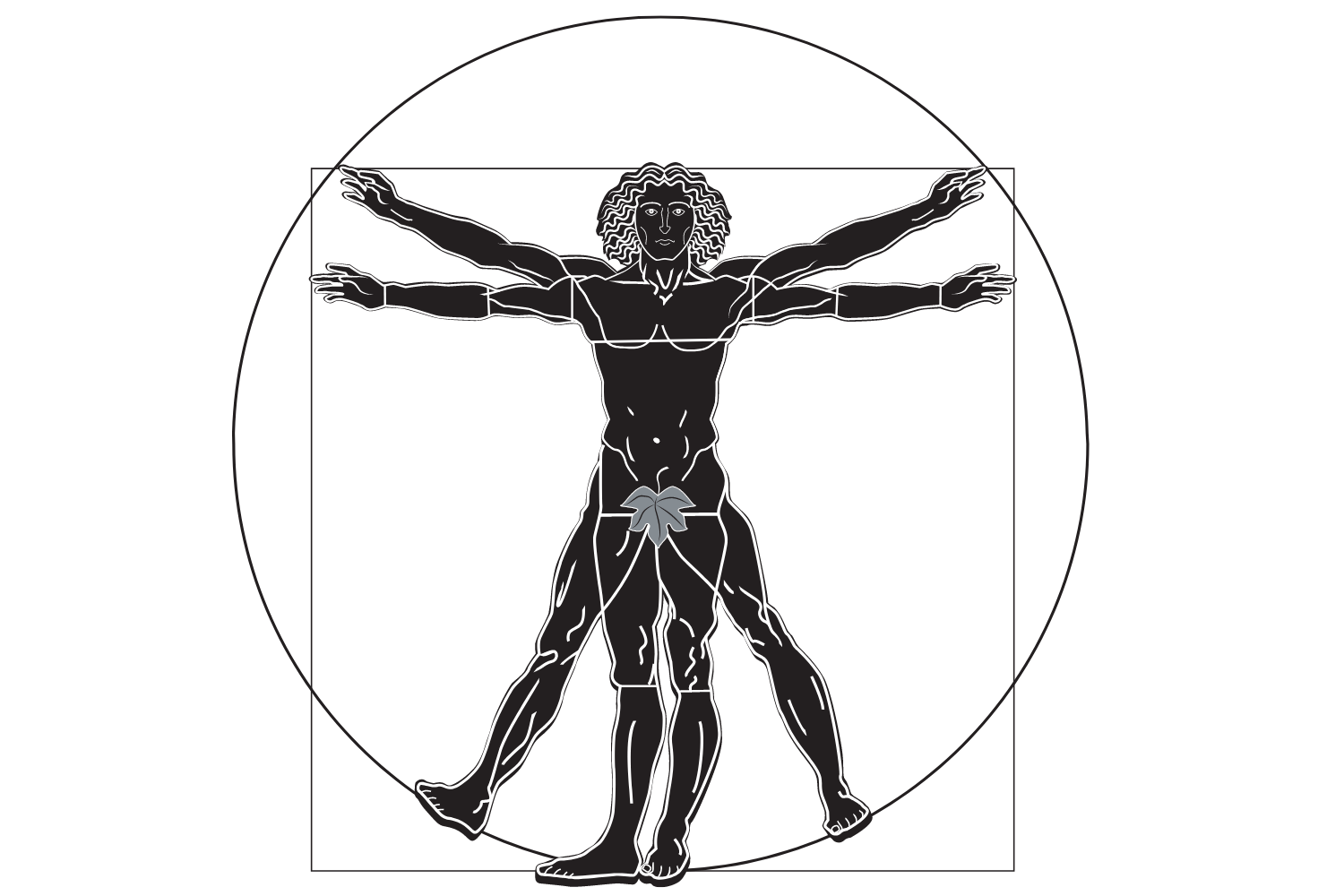Gesetzt, dass Wesenserkenntnis überhaupt möglich sei, setzen sich uns doch gerade beim Versuch, uns selbst zu begreifen, unüberwindliche Grenzen entgegen. Wir verfügen nicht über die Möglichkeit der intellektuellen Intuition; unser Denken ist diskursiv, es braucht den mühsamen Weg des schrittweisen Argumentierens. Wie aber, wenn wir uns selbst begreifen, ja sogar definieren wollen? Wie sollen wir mit unseren begrenzten Mitteln und Wegen den nötigen Abstand von unserem Sein gewinnen, um sagen zu können: dies ist der Mensch in seinem Wesen?
Die Tradition kümmerte dieses Problem wenig. Theoretisch-philosophische Selbsterkenntnis galt lange als die nahezu sicherste Form des Erkennens. Die Philosophie der Neuzeit nährte diese Überzeugung mit den kühnsten Vorgriffen in die Region der Selbstgewissheit. Sie wagte sogar, die Selbstreflexion, die Zurückbeugung des Blickes auf das Ich und seine gesicherte Sphäre, als Ausgangspunkt jeglicher weiterführenden philosophischen Erkenntnis anzusetzen.
Doch bereits in der Antike und im Mittelalter meinten Philosophen, einen Wesenskern feststellen zu können, der den Menschen auszeichnet und ihn von allem anderen Seienden unterscheidet. Die Griechen definierten den Menschen als zoon logon echon, als das Tier, das den Logos besitzt. Logos, der im Griechischen Verstand, aber auch Sprache bedeutet, wurde später mit ratio übersetzt und mit dem rationalen Vermögen gleichgesetzt. Die verschiedenen Bestimmungen des Seins des Menschen sind in der klassischen Philosophie allesamt Abwandlungen des Selbstverständnisses des Menschen als animal rationale: der Mensch ist das vernunftbegabte Tier, wobei die Vernunft bzw. der Verstand als die spezifische Differenz angesehen wurden, die den Menschen von allen anderen Tieren unterscheidet, eine Differenz, die den Menschen zum „Bewohner zweier Welten“, der materiellen und der rein geistigen, bestimmt. Als animal rationale ist der Mensch in der Tradition animal metaphysicum, das Lebewesen, das über einen ausgezeichneten Bezug zum Übersinnlichen verfügt. Dieser Wesensbezug befähigte uns, erfahrungstranszendierende Fragen wie die Existenz Gottes oder die Unsterblichkeit der Seele rational zu beantworten und uns selbst als absolute Ausnahme im Universum der existierenden Dinge zu verstehen. Kraft der philosophischen Selbstbestimmung als vernunftbegabtes Tier positionierte sich der Mensch inmitten des Seienden als dessen Herr und Verwalter.
Wenn spätestens mit Kant die Möglichkeit einer die Erfahrung transzendierenden Erkenntnis wesentliche Einschränkungen annehmen musste, so sind auch postkantianische, ja selbst „postmetaphysische“ Positionen nicht immun gegen die Versuchung, einen „Wesensort“ für den Menschen ausfindig zu machen. Zugegeben, kein ernsthaft Philosophierender würde sich heute mit einer allgemeinen Wesensdefinition des Menschen zufrieden geben. Wir haben den Anspruch auf eine globale Erklärung der Welt und unserer selbst längst aufgegeben, und wie es mir scheint zu Recht.
Doch vielleicht liegt in dieser ständigen Versuchung, gegen alle uns auferlegte Grenzen unser „Wesen“ begreifen zu wollen, mehr als ein bloßer Irrweg der Vernunft. Vielleicht sagt uns die Tatsache, dass diese Versuche immer wieder unternommen wurden, mehr über den Menschen als die jeweiligen Antworten, die die Philosophie gegeben hat. Vielleicht sagt uns diese verzweifelte Suche sogar sehr viel über die Frage, wer wir sind. Denn am Ende können wir wenigstens festhalten, dass der Mensch das Seiende ist, das die Frage stellen kann und vielleicht sogar stellen muss: wer oder was bin ich?
Wir wissen nicht, ob es auch andere Seienden gibt, die diese Frage stellen können. Das Sein der Tiere ist uns in seinem Innersten unzugänglich, über andere Lebensformen im Universum wissen wir nichts. Doch wir wissen, dass wir Menschen Wesen sind, die diese Frage stellen – und nicht erst in der Philosophie. Wir haben das Bedürfnis nach Antworten, die über das alltägliche Bestreiten unseres Lebens hinausgehen. Nicht immer, nicht ständig, aber immer wieder. Wir sollten uns davor hüten, die Frage nach unserem Sein für eine müßige Angelegenheit der Theorie zu halten. Sie ist eine existenzielle Frage, die unsere Hoffnungen und unsere Verzweiflung mit einschließt und für viele vielleicht erst angesichts des Todes eine umstoßende Brisanz gewinnt.
Der italienische Dichter Eugenio Montale schrieb einmal: „nur das können wir heute sagen, was wir nicht sind, was wir nicht wollen“. Vielleicht können wir uns selbst, nach Jahrtausenden Versuchen, uns nur noch per viam negationis beschreiben. Wir können von uns selbst sagen, dass wir Wesen sind, die anders als andere Seienden sich nicht nur im Gegebenen aufhalten können. Wir sind Wesen, die nicht sterben möchten und uns nicht damit begnügen können, das Fehlen eines letzten Sinnes hinzunehmen, selbst dann, wenn wir keinen Sinn mehr erblicken.
Der Mensch ist das Wesen, das nicht aufhören kann zu fragen: wer bin ich? Deshalb sind und bleiben wir uns selbst ein Rätsel. Wir sollten dieses Rätsel nicht beseitigen und nicht lösen wollen. Wir können unser Wesen nur umschreiben, anzeigen, ohne es zu benennen und in Besitz zu nehmen. Dieses Nicht-Können ist kein Mangel, sondern das Reichtum, dem wir die Kunst, die Dichtung, die Philosophie verdanken: die Frage, die wir nicht beantworten können und uns deshalb ständig und immer wieder aufgegeben ist.