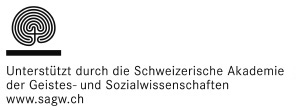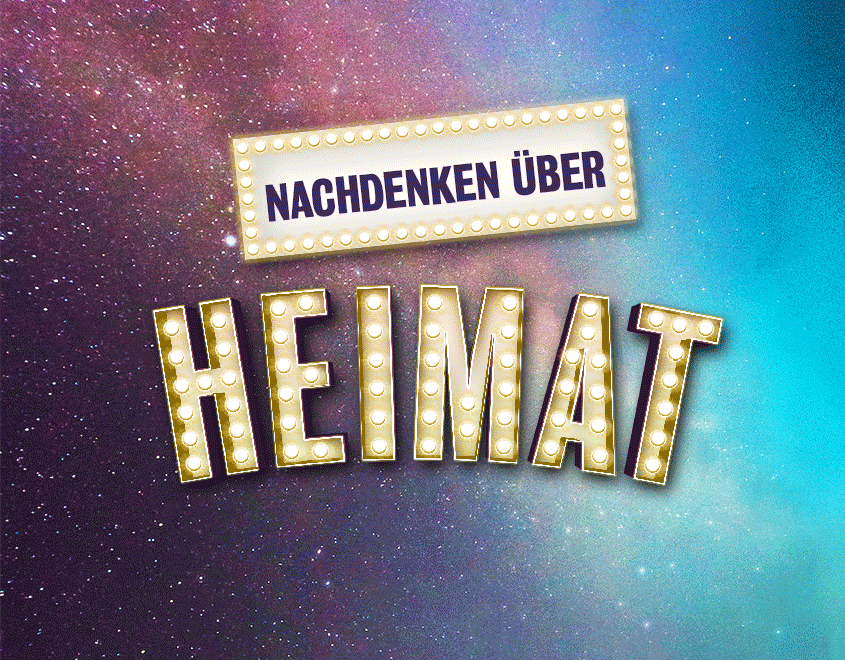Der Begriff „Heimat“ wird meist mit einer räumlichen, sozialen oder kulturellen Einheit in Verbindung gebracht, sei diese ein Land bzw. eine Landschaft, eine Sprache, eine (religiöse) Überlieferung oder die Gemeinsamkeit eines geschichtlichen Schicksals. Heimat bietet in diesem Sinne Sicherheit und Vertrauen; sie stiftet Identität und hat mit einem Gefühl des „Sich-zu-Hause-Fühlens“ zu tun. Im philosophischen Kontext taucht der Begriff eher selten auf; so wird man ihn in der Regel vergebens in philosophischen Lexika suchen. Hier begegnet schon eher der polare Begriff „Fremde“.
Der deutsch-amerikanische evangelische Theologe und Philosoph Paul Tillich (1886-1965), der 1933 aus Nazi-Deutschland in die USA emigrieren musste, beschreibt im zwölften Kapitel seines bekannten autobiographischen Essays mit dem bezeichnenden Titel „Auf der Grenze“ dieses polare Verhältnis unter der Überschrift „Auf der Grenze von Heimat und Fremde“[1] Von einer rein äußeren Emigration unterscheidet er hier einen Weg in die Fremde, die rein innerlicher Natur ist, und er versteht darunter: „Trennung von Glaubens- und Denkgewohnheiten. Überschreiten jeder Grenze dessen, was selbstverständlich ist, radikales Fragen und Vorstoßen zu dem Neuen, Unbekannten, dem ‚Kinderland‘ im Gegensatz zu allen Vater- und Mutterländern (Nietzsche).“ In diesem Falle ist das Fremde „nicht das räumlich andere, sondern das zeitlich Zukünftige, das ‚Jenseits der Gegenwart‘.“ Schließlich kann Tillich zufolge „Fremde“ aber auch noch „das Gefühl einer letzten Fremdheit gegenüber dem Nächsten, Vertrautesten bedeuten, jenes metaphysische Fremdheitserlebnis, das die Existentialphilosophie als einen Ausdruck der menschlichen Endlichkeit beschreibt.“[2]
Mit diesem letzten Aspekt hat sich der christliche Existenzphilosoph Peter Wust (1884-1940) näher beschäftigt. In seiner Vorlesung „Der Mensch und die Philosophie. Einführung in die Hauptfragen der Existenzphilosophie“ aus dem WS 1938/39 heißt es dazu: „Die Philosophie porträtiert uns also den Menschen selbst in seinem ewigen Auf und Ab zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Ruhe und Unruhe. Sie zeigt uns den Mensche als ein Wesen, das nie zu Hause ist: und deshalb immer nach Hause unterwegs ist (‚in via‘, ‚viator‘).“[3] Und weiter: „Vor allem ist der Mensch zunächst durch das Prinzip des Geistes ein Wesen der prinzipiellen Unruhe und Ungesichertheit. Diese prinzipielle Beunruhigung des Menschen vom Geiste her hängt damit zusammen, daß der Mensch im Gegensatz zum Tier ein aufgebrochenes Wesen ist. Das Tier ist in seinem Wesen gerundet, abgeschlossen, am Ziel, gesichert und von daher vitalbefriedigt. Wie die Kreislinie kehrt es in sich selbst zurück. Der Mensch aber ist ein Wesen, bei dem der Geist den in sich selbst geschlossenen Ring des Vitalen aufgebrochen hat. Deshalb ist der Mensch ein ‚ens indefinitum‘, ein unbestimmtes und unendlich bestimmbares Wesen, ein Wesen der unendlichen Daseinsunruhe, ein Wesen der prinzipiellen Ungesichertheit. Der Mensch ist in der Natur niemals ganz zu Hause; er ist ein in gewissem Sinne aus der Natur ausgestoßenes Wesen. Der Geist macht ihn heimatlos, rastlos, ruhelos in der Welt. Er kann nirgends bleiben, er muß immer weiter und weiter.“[4]
In seinem Hauptwerk „Ungewißheit und Wagnis“ von 1937 hat Wust diese prinzipielle Ungesichertheit und Heimatlosigkeit des Menschen näher analysiert und gezeigt, was das für die verschiedenen Ebenen des menschlichen Seins bedeutet, angefangen bei der vitalen, über die wissenschaftliche, die philosophische bis hin zur religiösen Dimension. Dabei ist entscheidend, dass der Mensch – im Gegensatz zum Tier – das prinzipiell ungesicherte Lebewesen ist, was seinen Grund darin hat, dass er unendlich bestimmbar ist: „Als reines Naturwesen ist das Tier in dieser Welt, in die es durch seine gesamten Sinnesorgane gleichsam hineingewurzelt ist, wirklich daheim und am Ziel.“ Als „Leibgeistwesen“, d.h. als „Sinnenwesen und Geistwesen“ ist der Mensch demgegenüber prinzipiell „heimatlos“.[5]
Diese Heimatlosigkeit wird nach Wust nirgends so deutlich porträtiert wie in der neutestamentlichen Parabel vom verlorenen Sohn (Lukas 15,11-32). Hiernach verlässt bekanntlich der jüngere der beiden ungleichen Brüder, allen Warnungen des weise vorsorgenden Vaters zum Trotz, die Gesichertheit des väterlichen Hauses und stürzt sich in das Wagnis einer unbekannten Welt. Wust deutet diese Parabel als ein Bild des Menschen schlechthin. Hiernach verlangt das Leben in seiner Sinnganzheit die unaufhebbare Dialektik von Geborgenheit und Ungeborgenheit. Es ist nicht so, als gäbe es nur die beiden Seiten der Geborgenheit (= Heimat) oder der Ungeborgenheit (= Fremde), sondern diese beiden Seiten sind dialektisch ineinander verschlungen: Es gibt eine Ungeborgenheit (= Fremde) in der Geborgenheit (= Heimat), und es gibt eine Geborgenheit (= Heimat) in der Ungeborgenheit (= Fremde). Das heißt, eine einfache Entgegensetzung von Heimat und Fremde greift zu kurz. Demgegenüber gilt es vielmehr, anthropologisch die prinzipielle Situation der menschlichen Ungesichertheit in den Blick zu nehmen, um auf diese Weise gefeit zu sein gegenüber falschen Sicherheiten und Gewissheiten, wie sie heute gerne von religiösen und politischen Fanatikern und Fundamentalisten der verschiedensten Couleur angeboten werden.
[1] Paul Tillich, Gesammelte Werke, Bd. XII, hrsg. von Renate Albrecht, Stuttgart 1971, 54-57.
[2] Ebd., 54f.
[3] Peter Wust, Der Mensch und die Philosophie. Einführung in die Hauptfragen der Existenzphilosophie, neu hrsg. und mit einer Einleitung und Anmerkungen versehen von Werner Schüßler, Berlin 2014, 74.
[4] Ebd., 78.
[5] Peter Wust: Ungewißheit und Wagnis, neu hrsg. im Auftrag der Peter-Wust-Gesellschaft von Werner Schüßler und F. Werner Veauthier. Einleitung und Anmerkungen von Werner Schüßler, Berlin 4. Aufl. 2014, 45.