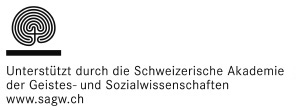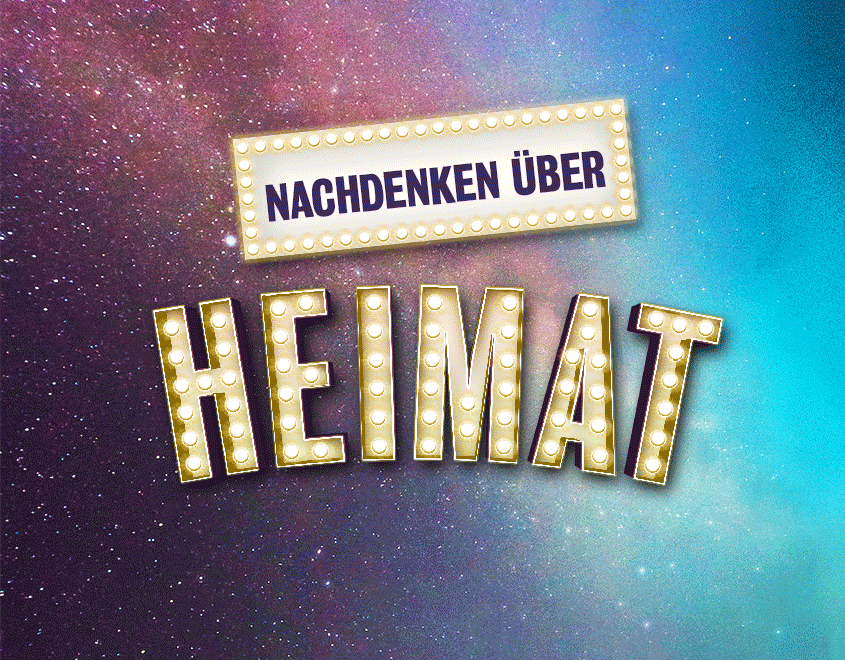Es ist ein Gemeinplatz, dass die Rede von Heimat aus bekannten historischen Gründen als ›belastet‹ gilt. Lässt sich dieser Begriff ungeachtet seines politischen Missbrauchs überhaupt noch ›unschuldig‹ verwenden? Wenn, dann allenfalls nachdem man eine rigorose Analyse der politischen »Perversion« vorgenommen hat, die ihn schwer in Mitleidenschaft gezogen hat, betonen Kritiker wie D. LaCapra. An dieser Stelle von Perversion zu sprechen impliziert die Frage nach einer nicht »perversen« und insofern akzeptablen Verwendung des Begriffs. Keineswegs muss man ihn zur Gänze verwerfen, ›nur‹ weil man ihn politisch missbraucht hat. Aber es erscheint fraglich, ob sich die Rede von Heimat gegen politischen Missbrauch überhaupt in Schutz nehmen lässt.
Phänomenologische Forschung zeigt, dass niemand von Natur aus, kraft autochthoner »Verwurzelung« oder angeblich seit je her »angestammten« Rechts, irgendwo beheimatet sein kann. Allenfalls werden wir beheimatet ‒ stets dank Anderer, bis auf weiteres und unter gewissen Bedingungen, die offenbar sämtlich widerrufen werden können. Einschlägige historische Erfahrung lehrt, dass wir uns einer Heimat politisch niemals vollkommen sicher sein können.
Das macht ‒ unter jeweils höchst unterschiedlichen historischen Umständen ‒ eine Literatur der Heimatlosigkeit und der Verlassenheit (genannt seien stellvertretend nur P. Levi, J. Améry, G.-A. Goldschmidt und A. Michaels) deutlich, die die Frage aufwirft, ob wir Heimat anders denken können denn als Berechtigung zu exklusivem, lokal »verwurzeltem« Dasein auf »angestammtem« Grund und Boden, mit dem man bei passender Gelegenheit »Front« macht gegen Andere, die bleiben sollen, »wo sie hingehören« und bei Bedarf ausgeschlossen und verjagt werden.
Wenn Heimat nicht nur als virtuell militante Phrase in diesem Sinne zu verstehen sein soll, die sich im europäischen Horizont bislang kaum aus einer Geschichte der Flucht und der Vertreibung lösen lässt, in der sie engstens mit rassistischen, völkischen und revanchistischen Ideologien verschwistert war, muss sie von vornherein zu gewährleisten versprechen, was letztere radikal negieren: die gastliche Aufnahme jedes Anderen, der Anspruch auf ein Dach über dem Kopf, auf eine menschenwürdige Wohnung und auf eine Bleibe hat, deren Verweigerung erst zu jener radikalen Heimatlosigkeit führt, die manche zu einem metaphysischen Schicksal erklärt haben. Wie auch immer es darum bestellt sein mag: sozial, politisch, kulturell heimatlos sind wir nicht kraft eines kosmologischen Verhängnisses, wie es von Pascal über Nietzsche bis hin zu J. Monod bereits vielfach ventiliert worden ist. Letzterer verlangt am Schluss seines hunderttausendfach verkauften Buches Zufall und Notwendigkeit, »der Mensch« müsse »endlich aus seinem tausendjährigen Traum erwachen und seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Er weiß nun, daß er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das […] gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen« ist. Sozial, politisch und kulturell heimatlos werden wir dagegen erst infolge der Verweigerung jeglicher Bleibe, die es möglich machen würde, über Formen der Duldung einer gleichgültigen Koexistenz hinaus eine Art Zuhause zu finden, das niemand je einfach ›hat‹. Zuhause dank einer nur von Anderen einzuräumenden Bleibe sind wir allenfalls als ursprünglich Welt-Fremde und in diesem Sinne originär Heimatlose, die lebenslang darauf angewiesen bleiben, politisch nicht im Stich gelassen zu werden ‒ wie es überall dort zu geschehen droht, wo die Institutionen verraten werden und erodieren, die versprechen sollten, eine verlässliche Welt zu gewährleisten.
Die oft als politische Heimatlosigkeit beschriebene Erfahrung der Unzuverlässigkeit politischer Lebensformen, die genau dafür einstehen sollten, ist nun aber nicht zu bestreiten. Was eine solche Welt fortan noch glaubwürdig wird versprechen können, bleibt ein für allemal überschattet von radikalen Versuchen, Anderen jegliche Bleibe zu verweigern. Wer seiner eigenen Heimat distanzlos verbunden geblieben ist, wird davon kaum etwas wissen können und uns insofern nur wenig lehren. Nur im Verhältnis zu Anderen, die mehr oder weniger tief greifenden Heimatverlust erlitten haben, kann überhaupt die Frage in ihrer radikalen, d.h. unser Leben konstitutiv betreffenden Tragweite zu Gesicht kommen, was es mit diesem Begriff auf sich hat. Es sind die politisch Verlassenen, die uns, sofern sie sich überhaupt als solche artikulieren konnten, lehren, wie neu danach zu fragen wäre, was mit diesem zweifelhaften Begriff heute vor allem auf dem Spiel steht: die elementare Bedeutung der Möglichkeit, sich an Andere wenden und Zuflucht bei ihnen finden zu können. Wo immer das möglich ist, kann, ihnen zum Dank, vielleicht eine neue Heimat gefunden werden, auch wenn jede ›alte‹ irreversibel zerstört ist. Wo diese Möglichkeit aber verbaut ist, verkommt alles ›Romantische‹, mit dem man diesen Begriff gern unpolitisch ausschmückt, zur puren Ideologie, wenn es von politischer Verlassenheit keine Spur mehr verrät. Die Bewährungsprobe praktischer Verlässlichkeit hat eine Heimat, die jemand zu ›haben‹ glaubt, allemal erst vor sich: im rückhaltlosen Angewiesensein auf Andere, die allein für sie politisch bürgen können.
An diesem elementaren Befund ändert die Einsicht nicht das Geringste, dass uns das Versprechen, allen Menschen eine würdige Bleibe zu bieten, in Zeiten der Globalisierung, verstärkter Migration und millionenfacher Flucht mit dramatischen Erfahrungen der Überforderung, des Missbrauchs unserer Gastlichkeit und anti-politischer Gewalt konfrontiert, die mitten ins Herz liberaler demokratischer Lebensformen zielt. Nicht zuletzt die öffentliche, politische Trauer nach den Ereignissen von Paris, Berlin und Manchester beweist, wie viele Europäer es gibt, die das begriffen haben, indem sie bekunden: wir versprechen den politisch Verlassenen trotz allem eine Bleibe.
Dieser Beitrag beinhaltet Kernthesen aus:
B. Liebsch, »Heimat für Heimatlose? Politische Überlegungen zur Literatur der Verlassenheit«, in: Ulrich Hemel, Jürgen Manemann (Hg.), Heimat finden ‒ Heimat erfinden. Politisch-philosophische Perspektiven, Paderborn: Wilhelm Fink, 2017.
Weiterführende Literatur:
B. Liebsch, Unaufhebbare Gewalt. Umrisse einer Anti-Geschichte des Politischen. Leipziger Vorlesungen zur Politischen Theorie und Sozialphilosophie, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft 2015.
B. Liebsch, Zeit-Gewalt und Gewalt-Zeit. Dimensionen verfehlter Gegenwart in phänomenologischen, politischen und historischen Perspektiven, Zug: Die Graue Edition 2017.
Perspektiven europäischer Gastlichkeit. Geschichte ‒ Kulturelle Praktiken ‒ Kritik, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft 2016 [Hrsg. mit Michael Staudigl und Philipp Stoellger].
B. Liebsch (Hg.), Der Andere in der Geschichte. Sozialphilosophie im Zeichen des Krieges. Ein kooperativer Kommentar zu Emmanuel Levinas’ Totalität und Unendlichkeit, Freiburg i. Br., München: Karl Alber 2016.