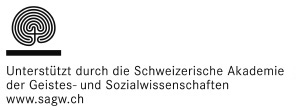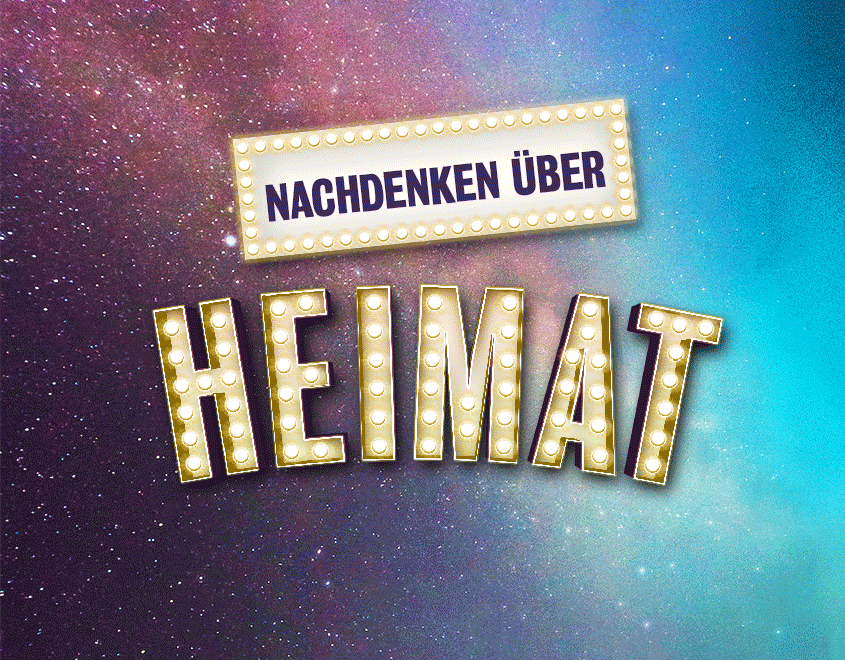Der Wunsch des Dichters redet keiner modernen Rastlosigkeit und Reiselust das Wort, auch nicht der selbstoptimierenden Zielsetzungseuphorie. Es ist ein Satz voll verzweifelter Sehnsucht. Ohne Thomas Brasch das Meinen des Folgenden unterschieben zu wollen, sei dieser Aufschrei deutsch-deutscher und künstlerischer Heimatlosigkeit mein Türöffner in das hier zu Bedenkende.
Bleiben will ich. Verweilen, Auf- und Durchatmen, fraglos sein, enthoben der Kritik und des Kritisierenmüssens. Tiefe Vertrautheit wünsche ich mir, nicht herzustellen, nicht aktiv aufsuchbar, nicht zu verdienen, nicht aufzubauen. Eine Heimstatt und Heimat, wohinein ich komme um bleiben zu können, ganz zu Hause zu sein, obschon ich dort nie gewesen bin.
Solcherart interpretiert ein wahrlich utopisches Verlangen in der entzauberten und durchverwalteten Welt. Ein hoffnungsloses Ansinnen unter den Vorzeichen transzendentaler Obdachlosigkeit. Romantisch überholt in einer von Identitäten, Nationen, Traditionen und ihren je eigenen Verkrustungen, Vorurteilen und Wahnvorstellungen tausendfach fragmentierten, von roten Linien, Gräben und Verletzungen durchzogenen Lebenswelt und Kommunikationskultur. Und grundlegender noch, schlicht unmöglich von unser aller Warte des Gefesseltseins an die definierende und negierende Sprache, die mächtige Vermesserin der Grenzen unserer Welt, die «Droge, für die Eiferer geradeso wie für die Egoisten» (Michel Serres), die uns, selbst wo wir sie unschuldig und aufrichtig verwenden, zuverlässig immer hinaustreibt aus dem Verweilen in die Distanz des Noch-nicht oder Zu-spät.
Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin. Nachdenken über Heimat? Ein Luxus in einer unfriedlichen Zeit, in der es für nicht wenige Menschen um die elementarsten Formen des Beheitmatetseins und Bleibenkönnens geht («Frieden ist, wenn du zu Hause sitzt» –
Sgrafitto von Hamlet an einer Mauer in Charkiw, Ostukraine). Oder gerade jetzt und durch die vielgestaltigen Entwurzelungen der globalisierten Existenz eine sich öffnende Wunde, somit eine Notwendigkeit? Ja. Aber wie kann dieses Nachdenken geschehen? So nicht als Geschwätz und Geraune von erdiger Scholle und goldenem Zeitalter, dann unausweichlich als Variation auf das uralte Lied von Verlust, Vertreibung, Exil oder als einer der vielen Lob- oder Abgesänge auf die Sprache als Heimat, auf die neuen und zweiten Heimaten, die fließenden Identitäten?
Ich entscheide mich, möglichst frei von allem, was einengt und verstellt, der Sehnsucht zu folgen. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin. Bleiben ist, so könnte man sprachketzerisch und schuldeutsch sagen, gar kein Tu-Wort. Es ist ein Hingabe-Wort. Bleiben ist mehr als Ver- oder Ausharren. Bleibend stehe ich still. Bleiben ist Erleben von Zeit, Ausfalten der Sinne in dem, was je gerade um mich ist. Ein Mich-Erfassen- und Beschreiben-Lassen wie ein leeres Papier. Nur im Bleiben ist das Glück der «Hautlichkeit» (Friedrich Nietzsche) voll auszukosten, das Eintauchen in Licht und Luft, das Gespür für Bodenelastizität, für Atem, Herzschlag, Haltung und Richtung. Wer Heimat denken will oder sich Heimat wünscht, muß die Identitäten des Weltreisenden, Weltenerklärers, Weltenerbauers ablegen, um sich elementar in die eigene Haut zu begeben. Eine Übung im Innehalten, Stehenbleiben. «Lassen Sie den Blick in alle Richtungen schweifen, improvisieren Sie», empfiehlt Michel Serres, denn: «Die Improvisation setzt den Gesichtssinn in Erstaunen.» Stehen, Staunen, desorientiert sein, sich die Sprache verschlagen lassen. Und da zeigt es sich (vielleicht), fällt es (vielleicht) wie Schuppen von den Augen, dass die einmal nicht flüchtig abgescannte oder überlegen be- oder ergriffene, sondern erschaute, erhörte, erspürte Wirklichkeit – fremd ist. Geheimnisvoll, aber dabei zutiefst vertraut.
‹Heimat› und ‹Geheimnis› haben dieselbe Wortwurzel. Sie tragen – vom heutigen Sprachgebrauch her erstaunlicherweise – das Moment tiefer Nähe in sich, die radikale Intimität einer Verbindung jenseits aller Kausalitäten und Begrifflichkeiten der mathesis universalis unseres Denkens. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin. Wer sinnlich und geistig staunend Fühlung aufnimmt mit diesem fremd-vertrauten Geheimnis, das das genaue Gegenteil eines lösbaren Rätsels oder einer unfruchtbaren Entfremdung ist, erhascht einen Zipfel dessen, woraufhin die Sehnsucht geht.
Nietzsche lässt seinen Zarathustra das ganz und gar immanente «Glück» der «plötzlichen Ewigkeit» preisen, in der ihm die Welt selbst sinnvollkommen wird. Die zeitgenössische Religionsphilosophie spricht im Rückgriff auf Heidegger von Manifestationen eines Sinnüberschusses im «Ereignis», das allein uns «das gibt, worin wir Leben und Sein haben, das wir brauchen wie die Luft zum Atmen.» (Jean-Luc Marion).
Für Romano Guardini wird, wer so mit allen Sinnen «vor die Wirklichkeit gelangt» im Letzten ihrer «Geschaffenheit» gewahr, des «Verwirklichtseins durch den Lebendigen Gott» (Guardini). Dieses «Geheimnisvolle und zugleich Tiefvertraute» zu vergegenwärtigen als das «Ur-Eigentliche und All-Eigentliche» (Guardini) der Geschaffenheit, ereignishaft vielleicht, aber von bleibender Konsequenz, würde alle Verhältnisse neu justieren, alle Perspektiven umkehren, die eigene Existenz neu orientieren.
Alles neu werden lassen – zur Heimat im Geheimnis.
Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin – Bleiben kann ich, wo ich immer schon war.
Niemand, zuletzt Guardini selbst, behauptet, diese Umkehrung sei voraussetzungslos oder einfach zu haben. Doch erlaubt sei, auch und gerade unter Philosophen genau diese Frage wachzuhalten – wie Guardini in einem Brief an einen Freund:
«Vielleicht kann man überhaupt nur im Geheimnis wohnen, geistig, und alle ‹Aufklärung macht das Atmen schwer›. Was meinst Du?»