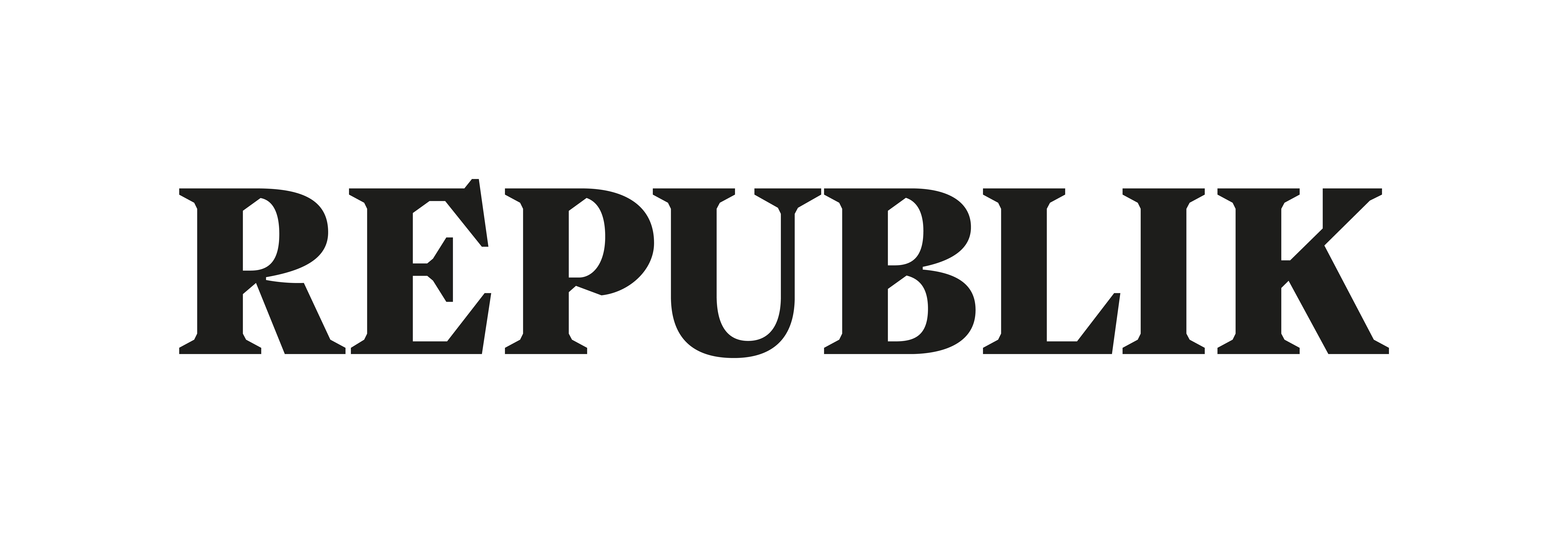An welchem Tag genau Adam Smith das Licht der Welt erblickte, ist nicht bekannt. Als sein Geburtstag dient deshalb gemeinhin der Tag seiner Taufe am 5. Juni 1723 in Kirkcaldy nördlich von Edinburgh. Anlässlich des 300. Jahrestags dieses Datums wollte er im Diesseits nachschauen, was aus seinen marktwirtschaftlichen Ideen geworden ist. Auf die aktuell vorgefundenen Verhältnisse von Wirtschaft und Gesellschaft reagiert er ziemlich verwundert.
Professor Smith, im Namen der Republik-Leserschaft danke ich Ihnen herzlich, dass Sie sich für dieses posthume Interview zur Verfügung stellen. Sie gelten bis heute als der wichtigste Vordenker des «freien Marktes». Welcher Satz aus Ihrem Werk repräsentiert nach Ihrer eigenen Einschätzung diese Lesart am prägnantesten?
Ich reisse nicht gern meine eigenen Sätze aus dem Zusammenhang, hat das doch allzu oft zu Missverständnissen geführt. Aber wenn es unbedingt sein muss – meine meistzitierten Sätze dürften aus meinem Werk «Der Wohlstand der Nationen» stammen: «Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nicht an ihre Menschen-, sondern an ihre Eigenliebe, und wir erwähnen nicht die eigenen Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil.»
Wer so spricht, dem geht es in der Regel doch nur um seinen eigenen Gewinn. Wo bleibt da das Gemeinwohl?
Gewiss strebt im Markt «jeder lediglich nach eigenem Gewinn». Aber – um in aller Bescheidenheit meine wirkungsmächtigste Formulierung zu zitieren – «er wird in diesem wie auch in vielen anderen Fällen von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu fördern, den zu erfüllen er in keiner Weise beabsichtigt hat. (…) Ja gerade dadurch, dass er das eigene Interesse verfolgt, fördert er häufig das der Gesellschaft nachhaltiger, als wenn er wirklich beabsichtigt, es zu tun.»
Kompliment für die Metapher der «unsichtbaren Hand»! Doch mit Verlaub: Sie bleiben da sehr allgemein. Ginge es auch konkreter?
Wenn Sie sich mit einem Erfahrungsbeispiel aus meiner Lebenszeit begnügen: Ich habe damals etwa die Vorzüge des Gewinnstrebens der reichen Grundbesitzer für die armen Landarbeiter beobachtet. Die Grundherren, so fand ich heraus, «verzehren wenig mehr als die Armen; trotz ihrer natürlichen Selbstsucht und Raubgier (…) teilen sie doch mit den Armen den Ertrag aller Verbesserungen, die sie in ihrer Landwirtschaft einführen. Von einer unsichtbaren Hand werden sie dahin geführt, beinahe die gleiche Verteilung der zum Leben notwendigen Güter zu verwirklichen, die zustande gekommen wäre, wenn die Erde zu gleichen Teilen unter alle ihre Bewohner verteilt worden wäre.»
Bei allem Respekt, aber Ihre Beobachtungen sind doch sonst viel genauer. Die Ungleichheit der Vermögensverteilung unter den Menschen ist enorm und hat seit Ihrer Lebenszeit überall, wo deregulierte Märkte geschaffen worden sind, weiter zugenommen. Muss nicht der demokratisch legitimierte Rechtsstaat für eine einigermassen gerechte Ordnung des Zusammenlebens sorgen?
Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Niemals habe ich die Ansicht vertreten, man könne die Regelung der öffentlichen Dinge der Privatwirtschaft überlassen. «Die bürgerliche Obrigkeit ist (…) mit der Macht betraut, den öffentlichen Frieden durch Eindämmung des Unrechts aufrecht zu erhalten»; darüber hinaus «kann sie Vorschriften erlassen, die nicht nur gegenseitige Schädigungen unter Mitbürgern verbieten, sondern bis zu einem gewissen Grade auch gegenseitige gute Dienste anbefehlen».
Interessant! Sie haben also das Primat der Politik vor der Logik des Marktes postuliert. Heute ist die Realität eine andere: Im globalen Standortwettbewerb wird die Politik den privatwirtschaftlichen Interessen und den von ihnen diktierten Sachzwängen des Marktes unterworfen. Was halten Sie von dieser Entwicklung?
Ich habe stets nachdrücklich davor gewarnt, die öffentlichen Dinge den eigennützigen Ideen der Kaufleute zu überlassen, denn: «Das Interesse der Kaufleute aller Branchen in Handel und Gewerbe weicht (…) stets vom öffentlichen ab, gelegentlich steht es ihm auch entgegen. Kaufleute sind immer daran interessiert, den Markt zu erweitern und den Wettbewerb einzuschränken. (…) Jedem Vorschlag zu einem neuen Gesetz oder einer neuen Regelung über den Handel, der von ihnen kommt, sollte man immer mit grosser Vorsicht begegnen. Man sollte ihn auch niemals übernehmen, ohne ihn vorher gründlich und sorgfältig, ja sogar misstrauisch und argwöhnisch geprüft zu haben, denn er stammt von einer Gruppe von Menschen, deren Interesse niemals dem öffentlichen Wohl genau entspricht und die in der Regel viel mehr daran interessiert sind, die Allgemeinheit zu täuschen, ja sogar zu missbrauchen.»
Das klingt ja geradezu wirtschaftskritisch. Sie glauben also gar nicht, dass mehr Markt automatisch zum Vorteil aller ist?
Ich bitte Sie: So einen groben Unsinn habe ich nie behauptet. Vergessen Sie nicht, dass ich in erster Linie Moralphilosoph bin und meine politische Ökonomie in ethischer Absicht entwickelt habe. Die faire Regelung des Handels und die Gerechtigkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse verstehe ich als unverzichtbare Voraussetzungen einer funktionierenden Marktwirtschaft: Es «kann eine Gesellschaft zwischen solchen Menschen nicht bestehen, die jederzeit bereit sind, einander wechselseitig zu verletzen und zu beleidigen. (...) Gerechtigkeit ist der Hauptpfeiler, der das ganze Gebäude stützt. Wenn dieser Pfeiler entfernt wird, dann muss der gewaltige, der ungeheure Bau der menschlichen Gesellschaft (…) in einem Augenblick zusammenstürzen und in Atome zerfallen.» Oder, um es noch deutlicher zu sagen: «Ungerechtigkeit wirkt (…) mit Notwendigkeit dahin, die Gesellschaft zu zerstören.»
Es genügt also doch nicht, wenn jeder einfach seine eigenen Interessen verfolgt?
Nie und nimmer! Ich muss mich ausdrücklich distanzieren von dem populistischen Win-win-Gerede, das sich im herrschenden Denken Ihrer Zeit nach allem, was ich so mitbekomme, wie Unkraut verbreitet hat. Beachten Sie bitte, dass es in einer zivilisierten Gesellschaft darauf ankommt, «die Lebensbedingungen unserer Mitbürger so sicher, erträglich und glücklich zu machen, wie wir können. (…) Derjenige ist sicherlich kein guter Bürger, der nicht den Wunsch hegt, mit allen Mitteln, die ihm zu Gebote stehen, die Wohlfahrt der ganzen Gemeinschaft seiner Mitbürger zu fördern.»
Und wo nehmen Sie das Vertrauen her, dass der politische Wille besteht, diese «Wohlfahrt der ganzen Gemeinschaft» zu gewährleisten?
Mein Vertrauen beruht letztlich auf dem, «was in Wirklichkeit die Weisheit Gottes ist», um es in der Sprache meiner Zeit auszudrücken. Sehen Sie: «Man mag den Menschen für noch so egoistisch halten, es liegen doch offenbar gewisse Prinzipien in seiner Natur, die ihn dazu bestimmen, an dem Schicksal anderer Anteil zu nehmen, und die ihm selbst die Glückseligkeit dieser anderen zum Bedürfnis machen, obgleich er keinen anderen Vorteil daraus zieht als das Vergnügen, Zeuge davon zu sein.»
Ist es nicht ein bisschen naiv, so sehr auf die altruistische Natur des Menschen zu setzen?
Nicht, wenn Sie die soziale Dimension des Menschseins einbeziehen. In ihr wurzelt die humane Moralität. Ein normaler Mensch kann gar nicht anders, als mit seinen Mitmenschen ein Stück weit mitzuempfinden und sich selbst aus deren Blickwinkel zu beurteilen. Schon als Kinder entwickeln wir dabei starke moralische Gefühle. «Wir billigen oder missbilligen das Verhalten eines anderen Menschen auf die Weise, dass wir uns in seine Lage hineindenken und nun unsere Gefühle darauf prüfen, ob wir mit den Empfindungen und Beweggründen, die es leiteten, sympathisieren können oder nicht. Und in gleicher Weise billigen oder missbilligen wir unser eigenes Betragen, indem wir uns in die Lage eines anderen Menschen versetzen und es gleichsam mit seinen Augen und von seinem Standort aus betrachten und nun zusehen, ob wir von da aus an den Empfindungen und Beweggründen, die auf unser Betragen einwirken, Anteil nehmen und mit ihnen sympathisieren könnten oder nicht.» Mit anderen Worten: «Wir bemühen uns, unser Verhalten so zu prüfen, wie es unserer Ansicht nach irgendein anderer gerechter und unparteiischer Zuschauer prüfen würde.»
Mit Verlaub: Wie passt das mit Ihrer Metzger-Brauer-Bäcker-Fabel zusammen, in der Sie das Hohelied vom wirtschaftlichen Erfolgsdenken gesungen haben?
Gute Frage. Ich wäre nicht Ökonom geworden, wenn mir nicht sehr früh bewusst geworden wäre, dass es da ein kleines Problem gibt: Manchmal «erscheint uns infolge der ursprünglichen, egoistischen Affekte der menschlichen Natur der Verlust oder Gewinn eines ganz kleinen eigenen Vorteils von ungeheuer grösserer Wichtigkeit (…) als die bedeutendste Angelegenheit eines anderen Menschen, zu dem wir in keiner besonderen näheren Beziehung stehen». Ich kam in meinen langjährigen ökonomischen Studien jedoch zum Ergebnis, dass das «einfache System der natürlichen Freiheit», also die Interessenverschränkung im marktwirtschaftlichen Tausch, diese Asymmetrie der moralischen Bindungskräfte zwischen den Menschen teilweise auszugleichen vermag. Dies hielt ich bis kurz vor meinem Lebensende für die geniale moralphilosophische List des marktwirtschaftlichen Systems.
Und was geschah dann?
Noch vor meinem Ableben musste ich die zunehmende Raffgier und die geschwächte Solidarität unter den Menschen zur Kenntnis nehmen, die meine liberale Wirtschaftsphilosophie aufgrund ihrer verkürzten Lesart ausgelöst hatte. Good heavens – das hatte ich nicht beabsichtigt. Deshalb liess ich das noch nicht ganz fertige Manuskript für mein drittes Hauptwerk kurz vor meinem Tod vernichten. Eigentlich wollte ich darin aufzeigen, wie der Staat die marktwirtschaftliche Kapitalverwertungslogik in gemeinwohldienlicher Weise bändigen kann. Doch ich sah am Ende ein, dass die Klammer zu schwach ausfallen würde und ich die liberale Synthese von Ethik, Politik und Ökonomik, die ich nach dem Vorbild von Aristoteles erneuern wollte, nicht mehr schaffen konnte. Soweit mir bekannt ist, nennt ihr das heutzutage «das Adam-Smith-Problem». Ich hielt es am Ende für wahrhaftiger, die Problemlösung meinen Nachfolgern zu überlassen.
Ihre Skrupel ehren Sie. Aber die meisten «reinen» Ökonominnen verstehen heutzutage Ihr Problem gar nicht: Sie lesen kaum mehr Ihre «Theorie der ethischen Gefühle» und beachten somit auch nicht die Voraussetzungen, unter denen Sie die Marktwirtschaft überhaupt erst für gemeinwohldienlich hielten. Deshalb glauben nicht wenige von ihnen, die grosse Harmonie im gesellschaftlichen Kräftespiel bilde sich als automatische Folge des deregulierten Marktes – im enthemmten Wettstreit unter Wirtschaftssubjekten, die ihren puren Eigennutzen maximieren.
My God! Wenn, wie Sie sagen, inzwischen sogar manche Ökonomen einem so weltfremden Marktglauben anhängen, dann muss es ja noch viel schlimmer gekommen sein, als ich in meinen pessimistischsten Momenten erahnt habe. Welch eine unangenehme Vorstellung für einen schottischen Moralphilosophen! Nicht der Markt, sondern «Vernunft, Grundsatz, Gewissen [ist] der grosse Richter und Schiedsherr über unser Verhalten». In Ihrer Epoche wäre ich deshalb zum gründlichen Kritiker dieses pseudoliberalen Marktfundamentalismus geworden. Ich möchte nicht überheblich sein, aber das 21. Jahrhundert braucht dringend einen neuen Adam Smith. Einen Aufklärer!
Zur verwendeten Literatur
Die zitierten Stellen beziehen sich auf die folgenden beiden Ausgaben der Werke Adam Smiths:
«Der Wohlstand der Nationen». Übersetzt und herausgegeben von Horst Claus Recktenwald. Deutscher Taschenbuch-Verlag, 1978. Originaltitel: «An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations», 1776.
«Theorie der ethischen Gefühle». Übersetzt und herausgegeben von Walther Eckstein. Felix-Meiner-Verlag, 1985. Originaltitel: «The Theory of Moral Sentiments», 1759.