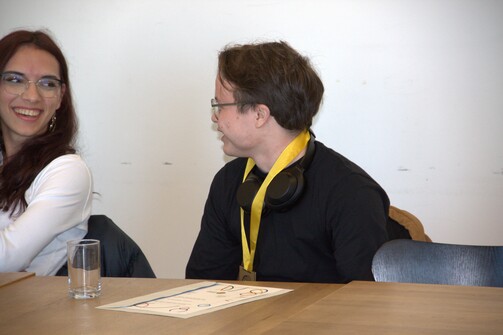Wir schreiben das Jahr 1950 und gehören zur indigenen Bevölkerung des damaligen belgischen Kongo. Natürlich sind nicht einverstanden damit, dass wir von der belgischen Kolonialmacht beherrscht werden und von den Weissen rassistisch diskriminiert werden. Wir engagieren uns deswegen politisch für gleiche Rechte und die Unabhängigkeit des Kongos von Belgien. Oder wir leben 1955 als Frauen in der Schweiz und kämpfen für das Stimmrecht.[ii] Doch was, fragen wir uns, müssen wir tun, damit wir diesen Kampf gewinnen? Und gibt es irgendetwas, wovon wir Gebrauch machen können, das uns retten kann? Ziel dieses Essays ist es darzulegen, warum die Antwort auf diese Frage weder die Philosophie noch die Intelligenz sein kann. Zumindest nicht nur. Franz Fanon schreibt:
« (…) wenn mir ein antillanischer Philosophie-Lizentiat erklärt, er könne wegen seiner Hautfarbe kein Staatsexamen ablegen, dann sage ich, dass die Philosophie noch nie jemanden gerettet hat. Und wenn ein anderer mir unbedingt beweisen will, dass die Schwarzen genauso intelligent seien wie die Weissen, dann sage ich: auch die Intelligenz hat noch nie jemanden gerettet; und das stimmt, denn wiewohl man im Namen der Intelligenz und der Philosophie die Gleichheit der Menschen verkündet, beschliesst man in ihrem Namen auch deren Ausrottung.» (Franz Fanon, Schwarze Haut, weisse Masken, 1952)
Strukturelle Diskriminierung und Unterdrückung
Bevor Fanons Zitat genauer ausgeführt werden kann, ist es wichtig, die Begriffe «Diskriminierung» und «Unterdrückung» für diesen Essay im Sinne von «struktureller Diskriminierung» und «struktureller Unterdrückung» zu definieren. «Strukturell» bedeutet, die Diskriminierung oder Unterdrückung tritt nicht als ahistorischer Einzelfall auf, sondern kann auf eine jahrhundert-, z.T. auch jahrtausendlange Geschichte zurückverfolgt werden und wurde im Laufe dieser Geschichte zu einem festen Bestandteil des gesellschaftlichen Systems / der gesellschaftlichen Struktur der Gesellschaften, in denen Menschen bis heute leben. Solche Arten der Diskriminierung und Unterdrückung wirken zum Beispiel auch ökonomisch und institutionell. Sie wurden historisch oft gesetzlich festgeschrieben, können aber auch ohne entsprechende Gesetze entstehen und fortbestehen. Dabei gibt es eine oder mehrere Gruppen, die aufgrund tatsächlicher oder zugeschriebener Merkmale konstruiert und oft von aussen abwertend definiert werden. Diese werden diskriminiert und unterdrückt. Im Gegenzug gibt es dann eine Gruppe von Privilegierten, die sich durch Abgrenzung von der / den unterdrückten und diskriminierten Gruppe(n) definiert. Diese Gruppe ist in einer gesellschaftlichen Machtposition, die durch die strukturelle Diskriminierung und Unterdrückung aufrechterhalten wird und diese wiederum ermöglicht. Die Abgrenzung und Gegenüberstellung dienen dabei auch der Legitimierung der Diskriminierung und Unterdrückung. Weil die Diskriminierung Teil der Gesellschaftsstruktur ist, werden alle Mitglieder der Gesellschaft (auch) diskriminierend sozialisiert und die Diskriminierung erscheint oft nicht als solche, sondern als «natürliche» oder «objektive» Gegebenheit (, die sie nicht ist). So kann sie auch unabsichtlich reproduziert werden. Einige Beispiele für solche Arten der Diskriminierung und Unterdrückung sind Sexismus und Misogynie, Transfeindlichkeit, Rassismus, Ableismus und Klassismus. Auch mit «Gewalt» ist im Folgenden «strukturelle Gewalt» gemeint.
Philosophische Nicht-Rettung: Kants Würde
Nun aber zurück zu Fanon, der schreibt, die Philosophie sei nicht die Rettung: Es gibt Menschengruppen, die 1950, aber auch heute noch strukturell diskriminiert werden. Wenn wir ein Problem damit haben, liegt es nahe, nach Argumenten oder ganzen (ethischen) Theorien zu suchen, die dies als unethisch entlarven und das Ende solcher Diskriminierung und Unterdrückung fordern. Besonders gut würde sich eine Ethik eignen, von der zumindest ein grosser Teil der Unterdrückenden überzeugt ist oder sich überzeugen lässt. Dabei könnte man zum Beispiel an den Kantianismus und Immanuel Kants Begriff der «Menschenwürde» denken. Diese ist unveräusserlich, unaufwiegbar und nur durch das Menschsein bedingt. Aus dieser Menschenwürde werden dann sämtliche Menschenrechte abgleitet, auch das Recht auf ein Leben frei von Unterdrückung und Diskriminierung. Schaut man sich aber genauer an, woraus Kant diese Würde ableitet, steht man schnell vor Problemen. Kant nämlich leitete die Würde vom Verstand ab. Den wiederum sprach er zum Beispiel kolonisierten Völkern ganz oder teilweise ab, sodass sie nicht genug oder gar keinen besässen und keine solche Würde hätten. (Weisse) Frauen hätten gemäss Kant zwar Verstand, doch eine andere Art des Verstandes, woraus sich ebenfalls keine Würde ableiten liesse. So sprach Kant genau denjenigen Menschen, die diskriminiert und unterdrückt werden und wurden, die Menschenwürde, die eine solche Diskriminierung ethisch verbieten könnte, ab. Auch wenn die Menschenwürde, so wie sie zum Beispiel in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgeschrieben wurde, für alle Menschen, auch rassifizierte Menschen, Frauen, behinderte Menschen oder Queers, gilt, kann Kant so nicht als Retter von, sondern muss stattdessen als Legitimator, der Diskriminierung gelten.
(Doch auch wenn es Kant - so darf man wenigstens hoffen - nicht primär um die Legitimierung von Diskriminierung, Gewalt und Unterdrückung ging, gab und gibt es immer wieder Versuche, Philosophie zur Rechtfertigung von Verletzungen der Menschenwürde heranzuziehen. So (miss-)brauchte die Schwester Nietzsches dessen Philosophie, um die nationalsozialistische Ideologie philosophisch zu begründen und zu rechtfertigen.)
Intelligenz und Assimilierung
Obwohl Diskriminierung auch dann bestehen kann, wenn sie als solche entlarvt wird, sollte und soll sie auch durch scheinbar wissenschaftlich fundierte Theorien legitimiert werden. Ein Beispiel hierfür stellen verschiedene rassistische Theorien dar, die die Kolonisierung von Gebieten und Menschen im globalen Süden vor allem durch europäische Länder, wie Grossbritannien, Frankreich und Belgien[iii], aber auch Rassismus im Allgemeinen legitimieren und als (natur-)wissenschaftliche Fakten darstellen sollten. Rassistische Theorien können, Ibram. X. Kendi, Professor für Geschichte und Gründer des BU Center for Antiracist Research, zufolge, grob in zwei Kategorien eingeteilt werden, die er in seinem Buch Gebrandmarkt, genauer erklärt: segregationistische Theorien und assimilationistische Theorien. (Segregationistische Theorien behaupten, es gäbe verschiedene menschliche «Rassen» – öfter wird mittlerweile auch der Begriff «Kultur» anstelle von «Rasse» verwandt –, die keine gemeinsamen Vorfahr*innen haben, niemals gleich und deswegen nie gleichwertig und gleichberechtigt sein können und dürfen.)
Wichtiger für diesen Essay sind die assimilationistischen Theorien. Ihnen zufolge haben alle Menschen(-Gruppen) die gleichen Vorfahr*innen, haben sich aber aufgrund äusserer Umstände über viele Jahrhunderte, gar Jahrtausende, hinweg unterschiedlich weit entwickelt. Weisse, westeuropäische und nordamerikanische Menschen stehen gemäss solchen Theorien auf der obersten Stufe der Evolution, People of Color weiter unten. Deswegen, so die assimilationistischen Theorien herrschen sie über die weniger entwickelten Gruppen und helfen ihnen, sich weiterzuentwickeln, bis sie denselben Entwicklungsgrad erreicht haben. Eine Eigenschaft, die bei weissen Menschen (vor allem aber bei weissen cis Männern) am weitesten entwickelt sei und diese überlegen mache, sei die Intelligenz. Auch die Unterdrückung von Frauen wird mit dem Argument, sie seien (noch) nicht gleich intelligent wie Männer, zu legitimieren versucht. Als «Intelligenz» gilt dabei nur diejenige, die den Unterdrückern zugeschrieben wird und die konform mit solchen assimilationistischen Theorien ist.
Die These, dass Unterdrückte, wenn sie nur intelligent genug sind oder werden nicht mehr unterdrückt werden, ist problematisch und falsch. Sie erklärt ebensolche diskriminierende Theorien für wahr. Weil die Standards der Unterdrückenden zum Ziel erklärt werden – an sie sollen Unterdrückte sich assimilieren – werden diese für tatsächlich überlegen und wertvoller erklärt. So wird der diskriminierende Ist-Zustand legitimiert. Und weil Ziele dieser Theorien die Legitimierung und die Unsichtbarmachung von Diskriminierung, indem diese als scheinbar natürliche und nicht menschgemachte Gegebenheit dargestellt wird, sind, kann aus dieser Theorie nicht die Befreiung hervorgehen. Es kann nicht gelingen, die Unterdrücker mit besseren, intelligenteren, logischeren Argumenten zu überzeugen, nicht zu diskriminieren, auszubeuten oder zu unterdrücken. Nicht solange das Ziel dieser nicht ethisches Verhalten, sondern der Erhalt der eigenen Privilegien und Machtposition ist.
Notwendigkeit von Intelligenz und Philosophie
Trotzdem spielen Intelligenz und Philosophie eine wichtige Rolle im Kampf gegen Diskriminierung und Unterdrückung. Damit Menschen den Weg aus der Unterdrückung finden können, ist es unbedingt nötig, dass sie von der Unterdrückung wissen. Ein Mensch, der seine prekäre Situation als naturgegeben, als gottgegeben, vor allem aber unveränderbar begreift, wird sich nicht damit aufhalten, dagegen anzukämpfen. Wenn Intelligenz nicht diejenige meint, die, so wie in assimilationistischen Theorien, die der Unterdrücker, oder eine, von der sie profitieren, ist, dann ist Intelligenz nicht Teil der Unterdrückung, sondern ein notwendiges Mittel der Befreiung. Das ist der Fall, wenn Intelligenz als die Fähigkeit, komplexe(re) Sachverhalte zu verstehen und zu hinterfragen definiert wird.[iv] Diese Intelligenz ist Voraussetzung dafür, dass Diskriminierung als solche erkannt und als unethisch und veränderbar begriffen werden kann.
Und auch wenn durch Philosophie (und andere Geistes- Sozial- und auch Naturwissenschaften) zu oft Diskriminierung, Unterdrückung und Gewalt legitimiert werden soll(te), spielen gerade die Geistes- und Sozialwissenschaften eine bedeutende und notwendige Rolle im Kampf dagegen. Diese Disziplinen erlauben es, frühere und gegenwärtige Gegebenheiten zu hinterfragen. Sie können untersuchen und gegebenenfalls auch beweisen, ob etwas sozial konstruiert wurde oder wird. Es kann erforscht werden, wie Diskriminierung heute fortbestehen kann und mit welchen Mitteln dagegen vorgegangen werden kann und soll, warum Wissen und Hinterfragen allein noch nicht reichen und was zusätzlich nötig ist. Wenn das Ziel das Ende diskriminierender Systeme ist, muss auch darüber nachgedacht und verhandelt werden, wie eine neue Struktur, eine neue Gesellschaft aussehen soll und wie wir auf eine ethische Art und Weise dahin kommen.
Fazit
So lässt sich abschliessend festhalten, dass gerade ein Philosoph wie Kant, der mit seinem Würdebegriff eine starke ethische Grundlage für den Kampf gegen Diskriminierung hätte liefern können, ebendies nicht tat. Stattdessen lieferte er die philosophische Legitimierung für das Fortbestehen der Unterdrückung. Auch aus dem Beispiel von Nietzsches Schwester sowie der assimilationistischen Theorien geht hervor, dass die Philosophie und andere Wissenschaften zu oft nicht den diskriminierenden Status quo hinterfragten, sondern sich vielmehr damit beschäftigten, diesen zu legitimieren oder gar noch nicht vorhandene Formen von Gewalt zu fordern und zu begründen. Auch die Behauptung, ein gewisser Grad an Bildung oder Intelligenz würde vor Diskriminierung und Unterdrückung retten, kann nicht als wahr gelten. Sie geht geht vielmehr aus einer nicht hinterfragenden Übernahme diskriminierender Theorien hervor, wodurch diese wiederum legitimiert werden. Und doch sind Philosophie und Intelligenz notwendig, um Unterdrückung erkennen, verstehen, und dagegen vorgehen zu können. Es muss also nicht diskutiert werden, ob Philosophie und Intelligenz retten können, sondern welche Philosophie und wie Intelligenz verstanden und eingesetzt wird und zu welchem Ziel. Philosophie und Intelligenz müssen in diesem Zusammenhang als Mittel verstanden werden, die ethisch positiv, neutral oder negativ eingesetzt werden können.
Anmerkungen
[i] In diesem Essay stecken auch Ideen, Theorien und Konzepte, von denen ich über mehrere Jahre hinweg, vor allem im Rahmen meiner Maturaarbeit, in verschiedenen Texten und Büchern gelesen habe. Einige dieser Bücher sind Why We Matter (2021) und Das Ende der Ehe (2023) von Emilia Roig, Against White Feminism (2021) von Rafia Zakaria, Die Erschöpfung der Frauen (2021) sowie Revolution der Verbundenheit (2024) von Franziska Schutzbach und Gebrandmarkt (2017) von Ibram X. Kendi.
[ii] Die Beispiele wurden so gewählt, dass sie aus derselben Zeit kommen, wie Frantz Fanons Zitat. Es wäre genauso möglich, dass ein Mensch im heutigen Kongo oder eine Frau in der Schweiz oder sonst wo sich heute fragen, was es braucht, um Rassismus, (Neo-)Kolonialismus und patriarchale Diskriminierung zu beenden, auch wenn der Kongo heute zumindest rechtlich unabhängig ist Frauen seit 1955 etliche Rechte erstreiten konnten.
[iii] Der damalige Belgische Kongo war zuerst Privatkolonie des belgischen König Leopold II.
[iv] Zusätzlich könnten die Fähigkeit komplexe Themen gut zu erklären und Wissen so zugänglich zu machen aber auch Kompetenzen, die nötig sind, um Allianzen zu bilden unter diesen Begriff fallen.