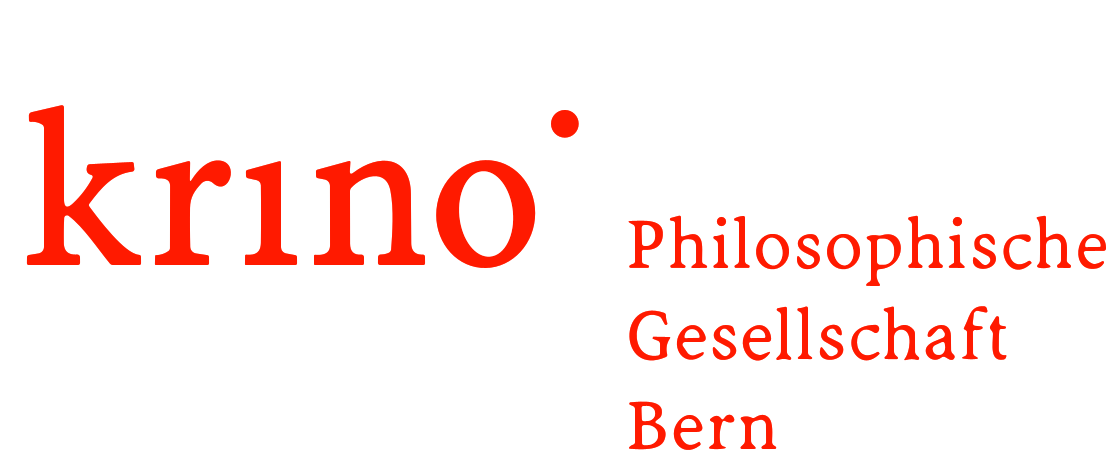Veranstaltungszyklus 2025: Ich bin so frei!? Facetten der Freiheit aus philosophischer Sicht
"Der Mensch ist frei geboren und liegt überall in Ketten." schrieb Rousseau im 18. Jahrhundert. Und trifft auch heute noch einen Nerv. Denn Freiheit ist uns wichtig, im Persönlichen wie im Politischen. Doch welche Freiheitsverständnisse werden in aktuellen Debatten vertreten und wie weit tragen sie? Welche Freiheitsversprechen sind in der Spätmoderne noch möglich? Und wie ist heute Wissenschaftsfreiheit zu denken? Die krino-Vortragsreihe im Frühjahr vertieft aktuelle Debatten über die Freiheit.
(entnommen von der Webseite der Krino)
20.03.2025
Prof. Dr. Tim Henning (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
Wissenschaftsfreiheit, moralische Kritik und epistemische Rechtfertigung
Dieser Vortrag begründet und verteidigt zwei Ansichten, die als unvereinbar erscheinen können. Erstens: Die Wissenschaft ist nur der Wahrheit verpflichtet. Insbesondere hat die Wissenschaft frei zu sein von politischen und moralischen Erwartungen, die den Bereich der zulässigen Positionen und Resultate in sachfremder Weise beschränken. Zweitens: Gleichwohl ist moralische Kritik an wissenschaftlichen Thesen möglich und mitunter geboten. Nicht jeder moralische Protest gegen wissenschaftliche Thesen (etwa aus der Intelligenzforschung oder der Forschung zu Geschlechtern) ist unzulässiger Moralismus. Wie sind diese beiden Positionen zu vereinbaren? Ich argumentiere für die Idee, dass die immanenten Kriterien wissenschaftlicher Rechtfertigung in Bereiche hineinreichen, die zugleich moralisches Terrain sind. Ähnlich wie wissenschaftstheoretische Autoren wie R. Rudner behaupte ich, dass die pragmatischen Kosten eines Irrtums zugleich epistemische und moralische Relevanz haben. Eine These zu vertreten, die in Anbetracht der Irrtumskosten zu schwach gerechtfertigt ist, kann zugleich eine wissenschaftliche und eine moralische Fehlleistung sein. Anders als vorhergehende Autoren begründe ich diese Position aber aus einer Analyse der theoretischen Vernunft und ihrer Autorität in Wahrheitsfragen.
27.03.2025
Dr. Philipp Schink (Goethe-Universität Frankfurt am Main)
Bin ich in meiner Badewanne Kapitän? Freiheit, Herrschaft und Kooperation
In vielen zeitgenössischen politischen Debatten und sozialen Auseinandersetzungen spielt der Begriff der Freiheit erneut eine große Rolle. Sei es im Kontext der politischen Bearbeitung der Klimakrise, von Meinungsfreiheit oder als gemeinsamer Bezugspunkt von Javier Milei, Elon Musk und der europäischen Rechten. Aber was für Freiheitsverständnisse genau stehen hier eigentlich im Hintergrund - und wenn, an welche philosophische Tradition schließen diese an?
Der Vortrag formuliert einige Einordungsvorschläge und zeigt ausgehend von diesen, wo es Probleme gibt.
03.04.2025
Dr. Carolin Amlinger (Universität Basel)
Hyperindividualisierung. Zur Kritischen Theorie spätmoderner Vergesellschaftung
Ein Individuum zu sein, genauer gesagt: ein Individuum sein zu können, ist das große Versprechen moderner Gesellschaften. Bis heute nimmt deshalb die Frage der Individualisierung für die Sozialtheorien der Moderne eine zentrale Rolle ein. Individualisierung wurde dabei als systematisch ambivalenter Prozess betrachtet: als eine Form der Befreiung und Zugewinn an Autonomie, aber auch als eine Form des Verlustes von Routinen, der Emergenz neuer Herrschaftsformen und Abhängigkeiten. Die Idee der Befreiung als eine inhärente Potenz des menschlichen Vermögens, die allenfalls durch äußere Schranken blockiert wird, muss unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen neu justiert werden. Die Antinomien, die sich zuvor weitestgehend auf die gesellschaftliche Differenz zwischen Institution und Person, zwischen Öffentlichkeit und Privatheit erstreckten, muss der Einzelne in der Spätmoderne selbst austragen. Der Vortrag lotet an diese Diagnose anknüpfend kritische Individualisierungstheorien aus, um der veränderten Vergesellschaftung von Individuen nachzugehen.