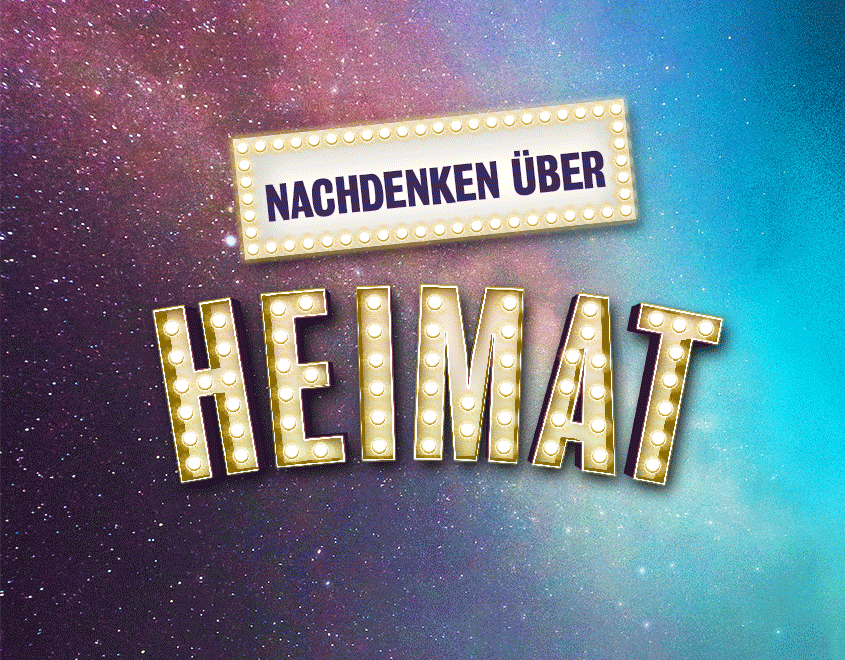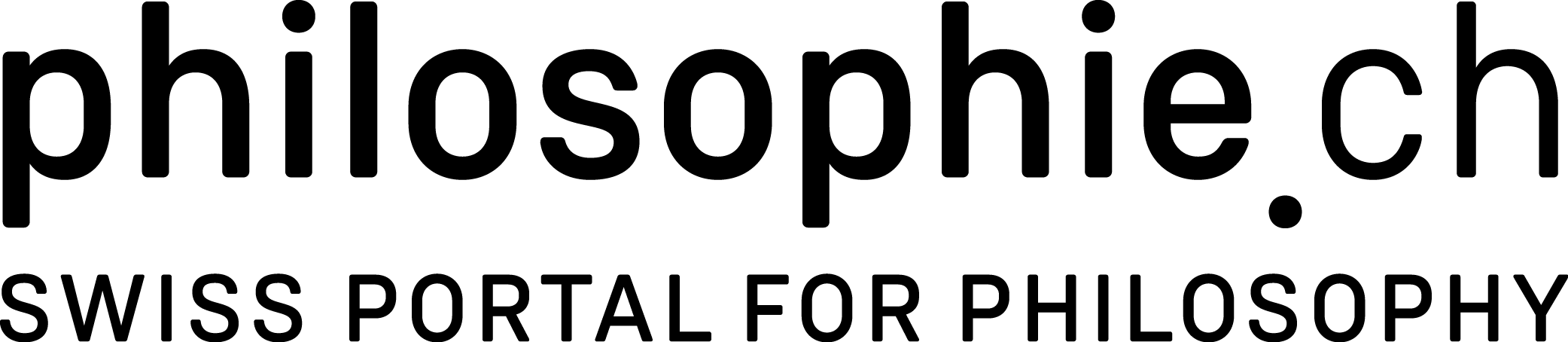Das Thema des ersten Salons im September war "Schweiz als Heimat" - nachfolgender Text von Elia Blülle:
Heimat: das Nest der Nationalisten
Wir wollen über Heimat diskutieren, sprechen aber über Rassismus und Rechtspopulismus. Was läuft hier schief?
Für mich war Heimat etwas Selbstverständliches. Sie war einfach da. Im Herbst der dumpfe Pilzgeruch des Waldes, der nussige Geschmack einer Rüblitorte und die Feuchte, welche sich nach dem Gang durchs Herbstlaub in die Schuhe schlich. Kindheitserinnerungen, Gefühle die Geborgenheit und Sicherheit hervorrufen. Und als ich vor ein paar Jahren in die Stadt zog, gesellten sich neue Eindrücke hinzu. Der Knall des Funkenschlages an der Tramoberleitung und der kräftige Espresso beim Italiener am anderen Ende der Strasse.
Aber meinen wir diese Erfahrungen, wenn wir von Heimat sprechen? Die Heimat begegnet mir üblicherweise in ganz anderen, in politischen Kontexten. So auch als Diskussionsteilnehmer am Salongespräch zur Frage «Was ist Heimat?». Wir besprechen die erlebbaren Nebenwirkungen des europaweiten Rechtsrutsches. Die Sehnsucht eines beachtlichen Teils der westlichen Bevölkerung nach abgrenzbaren nationalen Identitäten, die in der globalisierten Welt aufzulösen drohen wie eine Brausetablette im Wasserglas, und das damit verbundene Comeback von Rassisten und Angstmachern. Die Diskussion dreht sich um diejenigen Kräfte, die Heimat schützen und verteidigen möchten – gegen Ausländer, Linke und das sonstige Pack. Mit dem Herbstlaub und meiner Rüblitorte hat das nichts mehr zu tun.
Heute springt einen das Wort Heimat von überallher an. Aus allen politischen Ecken, aufgeladen und ideologisch erhitzt. Sie stellt mehr Fragen, als dass sie Antworten liefert. Durch seine Vieldeutigkeit ist sie prädestiniert für politischen Missbrauch. Im Wahlprogramm der Alternative für Deutschland ist die Rede von «Heimatschutzkräften» und es heisst, «jeder Migrant oder Einwanderer» müsse sich seiner «neuen Heimat und der deutschen Leitkultur» anpassen. Die wählerstarke nationalistische Partei Österreichs, die FPÖ, spricht im Parteiprogramm von der Politik aus «Liebe zur Heimat». Katrin Göring-Eckardt bedient sich desselben Vokabulars und sagte vor kurzem an einem Parteitag in Berlin: «Wir lieben dieses Land. Es ist unsere Heimat. Diese Heimat spaltet man nicht. Für diese Heimat werden wir kämpfen.»[1] Katrin Göring-Eckardt ist übrigens keine AfD Politikerin. Sie ist Grüne, gehört also derjenigen Partei an, die einst als linke «Anti-Parteien-Partei» in den 80er mit Turnschuhen und flatterndem Hemd in den Bundestag eingezogen ist.
Wenn sich eine Grüne-Politikerin plötzlich wie eine Nationalistin gebärdet, dann versucht sie entweder Stimmen am rechten Rand zu fischen oder – realistischer – sie will Deutungshoheit über einen Begriff zurückerlangen, die sie verloren hat. In einem Gastkommentar in der linken Tageszeitung «taz» unterstrich sie ein paar Tage nach ihrer Brandrede, dass der Begriff der Heimat nicht kampflos den Rechten überlassen werden dürfe.[2] Das Problem: Im Gegensatz zu den Nationalisten kann sie keine Antworten liefern auf die Fragen, welche dem Heimatsbegriff anhaften: Wem gehört die Heimat? Wer bestimmt, was Heimat ist? Was ist unsere Heimat?
Diese Fragen können nur mit Abgrenzung und Ausschluss beantwortet werden und sind so eine Vorlage für Parteien, die sich durch ihre Fremdenfeindlichkeit propagieren. Der Begriff Heimat tut sich schwer mit dem Pluralismus. Göring-Eckardt sagt nicht: Für unsere Heimaten werden wir kämpfen! Wir lieben unsere Heimaten! Der gemeinschaftliche Versuch – in der Partei, im Land, im Salon – die Frage zu beantworten, was «unsere Heimat» ausmacht, endet immer darin, dass die unbeteiligten Menschen ausgeschlossen und individuelle Vorstellungen von Identität und Lebenswelt aus dem Raum der politischen Heimatsideologie verdrängt werden.
Lässt man sich auf die politische Debatte um die Deutung von Heimat ein, geht der Plan der Nationalisten auf. Der Schriftsteller und Jurist Bernhard Schlink hat gesagt: «So sehr Heimat auf einen Ort bezogen ist, Geburts- und Kindheitsorte, Orte des Glücks, an denen man lebt, wohnt, arbeitet, Familie und Freunde hat – letztlich hat sie weder ein Ort, noch ist sie einer. Heimat ist Nichtort, Heimat ist Utopie.»[3]. Sie werde denaturiert, wenn Phantasie und Realität aneinander festgezurrt, der Nichtort zum Ort gemacht würde und die Heimatideologie politische und rechtliche Gestalt annehme. Sich in der Reaktion auf völkische Fantasien, der Diskussion um Heimat herzugeben, ist also eine Falle. Man beteiligt sich am Missbrauch des Heimatbegriffes und wird so unfreiwilliger Komplize.
Was tun mit der denaturierten Heimat? Mein Vorschlag: Überlasst die Heimat den Nationalisten, lasst sie in ihren Parteiprogrammen verstauben, bis sie als Überbleibsel der Vergangenheit ihren Reiz und somit ihre politische Wirkung verlieren wird. Das schliesst freilich die Sehnsucht nach einer persönlichen, an einen Ort gebundene Identität nicht aus. Aber das H-Wort? Dieses werde ich rechts liegen lassen.
[1] https://www.nzz.ch/feuilleton/die-gruenen-streiten-sich-ueber-einen-begriff-ld.1319781
[2] http://www.taz.de/!5451388/
[3] Bernhard Schlink, Heimat als Utopie, edition suhrkamp, Erste Auflage, 2000.
Das Thema des zweiten Salons im November war "Heimatlos. Zwischen Heimatbedrohung und Heimatverlust"
Das Thema des dritten Salons im Januar war "Heimat schaffen" - nachfolgender Text von Amina Abdulkadir:
(ohne Titel)
Sie steht im Bus, auf dem Sitz vor ihr ein Magazin. Es sitzt zu sehr, um es «liegen» zu nennen und liegt zu sehr, um es «sitzen» zu nennen. Auch ohne verbalisierbare Begrifflichkeit ist es aber eben nun mal so, wie es da ist. Das wäre wohl nicht einmal einen Gedanken wert. Doch auf der Titelseite steht: «Was ist Heimat?» Und wie sich der Bus bewegt und das Magazin wippt, scheint es, als würde das Magazin auf dem Sitz zu ihr sprechen, nein, eigentlich nicht sprechen, sie vielmehr fragen, was Heimat sei.
Wie verwegen, denkt sie sich. Solch eine Frage würde man sich noch nicht einmal während einem doch etwas zu lange geratenen Ausflug stellen. Nie, nein, nie würde man einen Abend mit dieser Frage verbringen, geschweige denn drei. Vielleicht wäre das ja aber gar nicht so schlecht, mit dieser Frage mal einen Abend, ja vielleicht sogar drei Abende zu verbringen. Und so kommt es nicht nur zum Gedanken, sondern gar zu einem Schmunzeln. Und dann erinnert sie sich wieder, nein, vielmehr erinnert das Magazin sie an das, was am Anfang dieses doch etwas zu lange geratenen Gedankens und des Schmunzelns einst stand und was da immer noch steht: Was ist Heimat?
«Eine verbalisierte Begrifflichkeit», denkt sie sich. So unförmig und brüllend wie «verbalisierte Begrifflichkeit» selbst. Brüllend, weil platzeinnehmend, platzdefinierend, auf der eigenen Bedeutung beharrend, auf «einer» Bedeutung, die für «jene» gilt. Und wer «jene» sind bestimmen jene. Deshalb auch unförmig, weil eben auch nicht formbar, nicht umformbar, nicht aneigenbar, weil verloren. Und so verliert auch sie sich, in verbalisierten Begrifflichkeiten, in Bergen und Wiesen, in Milch und Schokolade, in Chemie und Pharma, im «Schmüüsele» und «Chüderle», im «Chuchichäschtli» und «Choder», in all den CHs, die das Landeskennzeichen verewigt, einnimmt, vereinnahmt.
Und sie spürt sich da stehen, schon viel zu lange eigentlich, konfrontiert und deshalb eingesperrt und doch verloren, weil ausgestellt. Und sie steht, während das Magazin nicht sitzt und nicht liegt. Sie steht, weil sie stehen muss. Weil es verbalisierte Begrifflichkeiten gibt wie «Heimat» und «wir» und «die Anderen» und «Resilienz» und «Afrika», die sie zur Positionierung zwingen. Und sie steht und stellt sich vor, wie es wäre, zu sitzliegen oder zu liegsitzen. Stellt sich vor, im stabilen Schwebezustand zu sein, wie das Magazin. Stellt sich vor, einfach zu sein, unhinterfragt und ununterschieden.
Und sie steht, glaubt, stehen zu müssen, und merkt, dass sie stehen will. Dass sie schon immer stehen wollte. Sie will gar nicht sitzliegen und schon gar nicht liegsitzen. Sie will auch nicht unhinterfragt sein oder ununterschieden. Und wenn sie eingesperrt ist, dann doch nur im eigenen Körper. So, wie alle es sind. Eingesperrt in diesem Körper, mit dem sie schon viele Male ausgestellt und scheinbar verloren irgendwo stand. Irgendwo stand und vielleicht sogar etwas erzählt, etwas abgelesen hat. Etwas, das von ihr erzählt oder zumindest scheinbar von ihr.
Etwas, das hinterfragt und unterschieden wurde und wird. Etwas, das nur sie zu benennen weiss oder vielleicht noch nicht einmal sie. Etwas, das ihr gehörte, ihr gehört und ihres bleiben wird. Weil sie dieses Etwas gemacht hatte und es immer noch macht. Mit sich. Mit ihrem Sein. Mit dem einen Sein, das nur ihres ist. Das man ihr nicht nehmen kann. Nicht bekriegen, verarmen, krank machen oder bespucken kann. All das kann man mit Ländern tun. Mit Regionen. Mit Dörfern und Städten, ja gar mit Menschen. Aber eben nicht mit ihrem Etwas, nicht mit ihrem Innern. Ihr Inneres, in dem sie wohnt. Das Innere, das sie formt und das sie formt.
Denn ja, sie wohnt in ihrem Inneren, auch wenn sie ihr eigenes Inneres umhüllt.
Innen und aussen sind verbalisierte Begrifflichkeiten, störrisch und unzweckmässig, um Beziehung, um Körperlichkeit zu beschreiben. Und so steht sie da, «in sich» und «ausser sich» über diese Erkenntnis. Diese Erkenntnis, die sie mit niemandem teilen wird. Nein, nie, wird sie diese Erkenntnis mit jemandem teilen, geschweige denn mit mehreren. Sie wird sie für sich behalten, diese Erkenntnis, wie sie sich selbst für sich behält, während sie ihren Körper ausstellt. Nicht als Schutz, vielmehr als Projektionsfläche. Und sie sieht sich von innen heraus an, welche Bilder auf ihr gezeigt, welche Geschichten auf sie projeziert werden.
Sie sieht sich all das von innen heraus an, wundert sich über das Schlechte, das Gute und das Dazwischen. Und sie ist «in sich». Und sie steht. Und sie versteht.
Und sie fragt sich, ob die Menschen um sie herum wohl auch verstehen. Vielleicht nicht sie verstehen, aber doch vielleicht zumindest sich selbst. Ob sie sich selbst verstehen. Und ob sie auch «in sich» sind. Und ob nicht das vielleicht alle bestehenden, zukünftigen, ja gar alle denkbaren Begrifflichkeiten gegenstandslos, vielleicht sogar lachhaft macht. Und sie steigt aus, lässt das Magazin und seine Frage hinter sich, schmunzelt und ist «in sich».