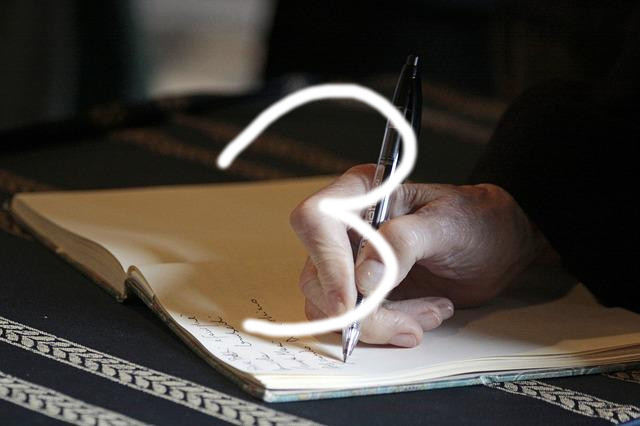Als ich diese Serie plante und ihr den Namen gab, ging ich davon aus, dass es ein Leichtes sein würde, wöchentlich zu publizieren. Wie der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Text (oder auch zu diesem hier) deutlich macht, war dies eine Fehleinschätzung. Ich beging den grundlegenden Fehler, jede Woche einen neuen Gedanken entwickeln zu wollen. Das ist aber bei beschränkter Zeit und Kreativität alles andere als einfach.
Ich möchte darum versuchen, aus meinen Fehlern zu lernen und ein Thema in mehr als einem Beitrag zu besprechen. Damit will ich auch verhindern, dass die Beiträge erneut einen solch absurden Umfang erreichen wie der letzte. Auch wenn es höchstens bei einem Text alle zwei Wochen bleiben wird – andere Projekte des Portals haben Vorrang.
Aber genug der zu späten Einsichten. Zum Thema der kommenden Artikel: Ich möchte die Hintergründe meines Themenschwerpunktes „Demokratie und Wahrheit“ näher beleuchten.
Das Verhältnis von Demokratie und Wahrheit begleitete mich in weiten Teilen meines Masterstudiums und stellt vielleicht so etwas wie den Kern der meisten meiner universitären Arbeiten dar – auch wenn sich diese mit sehr unterschiedlichen Aspekten des Verhältnisses auseinandersetzen.
Viele Themenfelder, die ich dabei streifte, eröffneten mir wiederum neue Fragen, mit denen ich mich gerne näher auseinandersetzen würde. Dies ist nach dem Studium, wie ich in den vergangenen Monaten feststellen musste, bedeutend schwieriger als noch während. Es fehlt in erster Linie die Zeit, sich länger auf ein Tehma zu fokussieren. Mir ist es deshalb eine grosse Freude, mich durch ein Projekt bei Philosophie.ch weiter mit diesen Themen zu befassen – sowohl über die Kuration des Themenschwerpunktes, wie auch durch die kleine Serie von Essays, die ich innerhalb dieses Formates publizieren kann.
Anfangen möchte ich im Rest dieses Beitrags mit einer Reflexion über das Verhältnis von Philosophie und Demokratie, denn auch sie ist Teil der Wissenschaften und somit Gegenstand des hier verhandelten Themas. Damit meine ich, dass in einer Wechselwirkung von Demokratie und Wahrheit Philosophie, sofern sie einen Anspruch auf Wahrheit erhebt, keine neutrale Position einnimmt: Philosophie selbst verhält sich in einer gewissen Weise zu Demokratie. Und dieses Verhältnis kann in zwei Weisen betrachtet werden:
- Deskriptiv: Philosophie als Wissenschaft mit einem Wahrheitsanspruch nimmt ein gewisses real historisches Verhältnis zu demokratischen Praktiken ein.
- Normativ: In der Philosophie wird darüber nachgedacht, wie sie sich zur Politik verhalten soll.
Unter den ersten Punkt fallen etwa historische oder soziologische Untersuchungen der Philosophie, die ihr Verhältnis zur Politik und Demokratie erörtern. Dabei wird dieses Verhältnis aus einer rein deskriptiven Perspektive betrachtet: welchen Einfluss hat die Philosophie auf die Politik? Hat sich dieses in den letzten Jahren verändert? Wie bestimmen politische Entscheidungen die akademische Philosophie – etwa über die Forschungsförderung?
Diesen Punkt werde ich allerdings im Weiteren beiseite lassen.
Der zweite Punkt ist eng mit dem ersten verbunden. Es geht allerdings nicht um ein deskriptives Verstehen eines bestimmten Verhältnisses zwischen Philosophie und Demokratie, sondern um eine normative Bestimmung desselben: Wie soll sich die Philosophie zur Demokratie verhalten? Soll sie anschliessend an ein Projekt der Aufklärung Demokratie unterstützen? Soll sie sich eines solchen Urteils enthalten? Oder soll sie gar, aus welchen Gründen auch immer, demokratische Regime bekämpfen?
Dass mich diese Frage beschäftigt, hat mehrere Gründe, auf die ich auch nicht alle eingehen kann. Ein sehr unmittelbarer ist, dass mir in einem Kommentar zum vorangegangenen Text „intellektuelle Weltverbesserung“ vorgeworfen wurde. Meine erste Reaktion war: Jawohl! Ganz genau das ist doch die Aufgabe der Philosophie!
Ganz so einfach ist es aber dann vielleicht doch nicht. Wie genau soll die Philosophie die Welt verbessern? Und eignet sie sich überhaupt dazu?
Über solche Fragen könnte man unzählige Bücher schreiben – und sie wurden es bereits. Es wäre deshalb völlig übertrieben, sie hier konsistent beantworten zu wollen – falls so etwas überhaupt möglich ist. Ich möchte allerdings meine erste Reaktion doch etwas untermauern.
Grundlegend für mein normatives Verständnis der Philosophie – also was Philosophie leisten sollte – ist der Pragmatismus. Es handelt sich dabei um eine Philosophie, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den USA entstanden ist.
Eine der Kernthesen dieser Philosophie ist es, dass Menschen immer schon in Handlungszusammenhänge eingebettet sind. Dass sie also, sobald sie auf der Welt sind, immer mit einer Umwelt interagieren müssen, um zu überleben.
Diese Behauptung scheint auf den ersten Blick nicht gerade bahnbrechend zu sein. Vermutlich haben die meisten Menschen irgendwann einmal in ihrem Leben so etwas gedacht. Aber, und das macht den Pragmatismus in meinen Augen so interessant, in seinen Theorien wird dieser Gedanke radikal zu Ende entwickelt. Damit ist gemeint, dass alle menschlichen Tätigkeiten als eine Form der Interaktion mit der Umwelt verstanden werden – also auch Philosophie und Wissenschaft.
Für John Dewey, einen Vertreter des Pragmatismus und einen meiner Lieblingsphilosophen, bedeutet dies, dass die Menschen zwei Formen von Erfahrungen machen: eine primäre und eine sekundäre. Die Primäre ist die direkte Erfahrung der Welt, ihrer Vor- und Nachteile, gefährlicher Situationen und des Genusses. Zu diesen primären Erfahrungen kommen sekundäre hinzu. Diese sind abstrahierende Erfahrungen, Erfahrungen von Zusammenhängen zwischen natürlichen Phänomenen, theoretischen Erfahrungen oder technischen Überlegungen.
Die Sekundärerfahrung besitzt bei Dewey keine eigenständige Wesensart. Sie ist immer auf die Primärerfahrung bezogen. Das bedeutet, dass sie eingesetzt wird, um gewisse Primärerfahrungen zu steigern und andere zu vermeiden. Das kann etwa bedeuten, dass theoretische Überlegungen angestellt werden, um Genuss zu steigern. Oder, um gewisses Leid zu minimieren. Es könnte dabei aber auch um ganz andere Werte gehen, die in unserem alltäglichen Leben wichtig sind.
Dewey macht hier einen Sprung in seiner Argumentation von der deskriptiven auf die normative Ebene: Da Sekundärerfahrung in auf die Primärerfahrung bezogen ist, sollte verhindert werden, dass sie sich voneinander entfernen – was Dewey etwa für eine abstrakte Wissenschaft diagnostiziert, die keinen Bezug auf das gesellschaftliche Leben nimmt. Wie genau dieser Sprung funktioniert, muss ich versuchen, in einem späteren Beitrag zu erklären.
Für die Philosophie bedeutet dies, dass auch sie gewisse Aufgaben in der Gestaltung unserer Umwelt übernehmen sollte. Auch wenn die Handlungen, mit denen wir auf unsere Umwelt, Dewey zufolge, einwirken, vielfältig sind, besitzen sie bei ihm alle eine politische Konnotation. Politik, speziell demokratische Politik, ist für Dewey nicht auf das Parlament, die Regierung und offizielle Institutionen beschränkt. Sondern alle unsere Handlungen können in einer Form politisch sein. Und sind auch potentiell demokratisch.
Dewey plädiert somit dafür, dass sich Philosophie im Speziellen und Wissenschaft im Allgemeinen als ein demokratisches Projekt verstehen – also alle Teil eines kooperativen Prozesses sind, unsere Umwelt so zu gestalten, dass Menschen ein gutes Leben führen können.
Dieses Bild stellt für mich einen zentralen Ausgangspunkt dar. Ich stimme mit Dewey darin überein, dass die Menschen in irgendeiner Weise dafür sorgen müssen, dass sie ihr Leben gut führen können. Dies funktioniert, so denke ich, ebenfalls gemeinsam mit Dewey, besser, wenn sie in Kooperation und intelligent vorgehen – wenn also wissenschaftliches Wissen in Entscheidungsfindungsprozesse einfliesst. Deshalb: intellektuelle Weltverbesserung? Unbedingt!, so lange sie Teil eines demokratischen Prozesses ist.
Ich könnte hier eigentlich enden. Die Schlusspointe gefällt mir ganz gut. Aber: ich muss hierzu noch etwas sagen. In Deweys Vorstellung bildet die Demokratie den grundlegenderen Wert, als die Wahrheit. Wahrheit als eine Sekundärerfahrung besitzt nur einen Wert, sofern sie in irgendeiner Form auf die primäre Erfahrung bezogen ist – also zum menschlichen Leben beiträgt. Dieser Diagnose stimme ich zu. Vielleicht nicht ganz ohne Vorbehalte.
Dewey geht aber auch davon aus, dass Wahrheiten, wie sie durch moderne Wissenschaften hervorgebracht werden, eine intime Beziehung zur Demokratie aufweisen. Beide Systeme würden im Kern nach den gleichen Prinzipien funktionieren. Für ihn ist es vielleicht auch deshalb kein Problem, die Wahrheit als Teil eines grösseren demokratischen Projektes zu verstehen, da sie sich strukturell ähneln. In beiden, so ist Dewey überzeugt, findet eine skeptische Selbstkritik und ständige Neuverhandlung von grundlegenden Prinzipien statt. Ich werde diesen Punkt in meinem nächsten Text genauer ausbauen. Für den Moment reicht die Zeit leider nicht aus.
Ich kann aber noch sagen: Hier bin ich mir nicht ganz so sicher wie Dewey. Und eine wichtige Motivation, verschiedene Texte zum Thema Demokratie und Wahrheit zu sammeln, entspringt daraus, dass ich die komplexen Konfliktlinien zwischen diesen zwei Feldern detaillierter untersuchen möchte. Denn: Was passiert, wenn Deweys Hoffnung sich als falsch erweist und Demokratie und Wissenschaften doch nicht prinzipiell miteinander verwandt sind? Kann das Primat einer demokratischen Politik dann noch aufrechterhalten werden? Oder müsste sich die Politik dem Diktum der Wissenschaften und der Wahrheit fügen?
Literatur:
Die Passagen über John Dewey beziehen sich in erster Linie auf:
The Quest for Certainty Band 4 und Liberalism and Social Action in Band 11 von Dewey, John. [1985]. The Later Works of John Dewey, 1925-1953, hrsg. Jo Ann Boydston, Carbondale/Edwardsville.