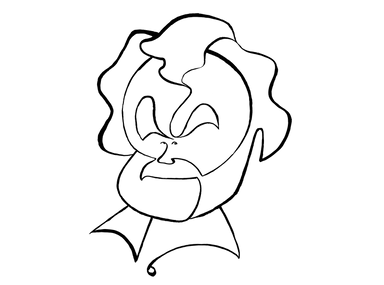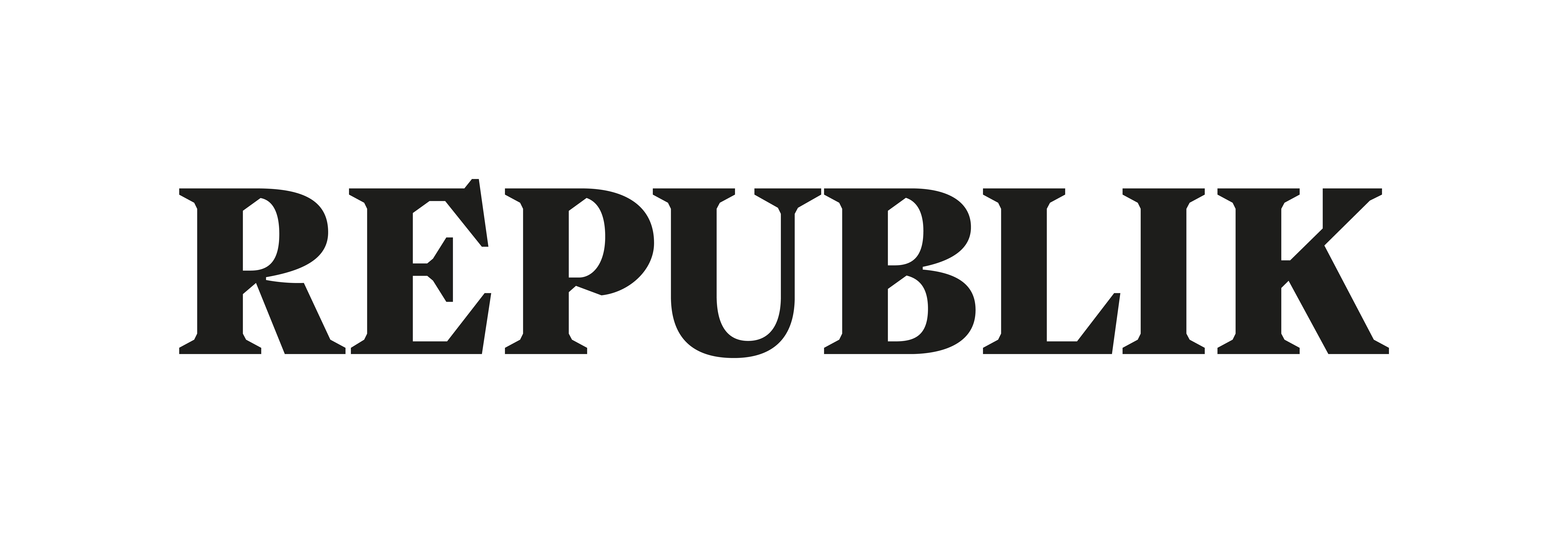«Ihr müsst miteinander reden!» Wer in seiner Beziehung in Schwierigkeiten gerät, erhält unweigerlich den Rat, mit der Partnerin zu reden. Wenn das Gespräch dann wieder im Streit endet, heisst es entweder, Streit sei positiv, man müsse nur über eine gute Streitkultur verfügen (was wahrscheinlich bedeutet, dass man keine Flammenwerfer einsetzen soll), oder dass es noch mehr Gespräch braucht. Ein Dritter muss hinzugezogen werden: «Habt ihr schon mal an eine Paartherapie gedacht?» ist der nächste, in Frageform gekleidete Ratschlag. «Manchmal braucht es einfach eine neutrale Zuhörerin.»
Auch in der Politik ist das Gespräch das Mass aller Dinge: Man darf die Covid-Leugner nicht als Covidioten bezeichnen, vielmehr muss man auf sie zugehen, das Gespräch suchen und ihnen erst einmal zuhören. Selbst nach dem Einmarsch von Putins Armee in die Ukraine entblödeten sich einige deutsche Intellektuelle nicht, dem Westen vorzuwerfen, das Gespräch mit Putin nicht zu suchen. Obwohl es keinerlei Anzeichen dafür gab, dass Putin auf ein Gespräch eingehen würde. So wenig wie die rechtsextreme Szene. Oder die Covid-Leugner. Oder die Klimaleugner.
Entschuldigen Sie, dass ich auch diese Geschichte wieder aufwärme: Als einige Besucherinnen der Brasserie Lorraine verlangten, das Konzert der Band Lauwarm abzubrechen, weil einer von ihnen Rastalocken trug, ging ein Aufschrei durch die Presselandschaft. Nicht die Forderung an sich wurde kritisiert, sondern dass sich die dafür Verantwortlichen nicht der Debatte stellten. Es gibt in einer demokratischen Kultur kein schlimmeres Vergehen, als das Gespräch zu verweigern. Eben veröffentlichte der Berner Rechtswissenschaftler Jörg Paul Müller ein Buch mit dem Titel «Dialog als Lebensnerv der Demokratie». Die Krise der Demokratie sei eine Krise des Gesprächs, meint er.
Die Idealisierung des Gesprächs steht in krassem Widerspruch zu seiner realen Erfolgsrate. Noch nie hörte ich in einer politischen Debatte den Satz: «Das habe ich mir so noch nie überlegt, ich muss meine Position wohl überdenken.» Die unzähligen Debatten und Diskussionen im Fernsehen kann man, wenn man erst einmal einige gesehen hat, auch allein, sozusagen als Ein-Personen-Stück mit verschiedenen Rollen, nachspielen. Man weiss schon zum Vornherein, was jede und jeder sagen und unzählige Male wiederholen wird. Was das Ergebnis privater Beziehungsgespräche betrifft, kann sich jeder selbst ein Bild machen.
Seit Platon seine Philosophie in die Form des sokratischen Dialogs gegossen hat, gilt die Suche nach der Wahrheit im Gespräch auch als Königsweg der Philosophie. Die Wahrheit wird dabei dem Konsens gleichgesetzt: Das Gespräch gelingt, wenn Konsens erlangt wird, und es misslingt, wenn weiterhin Dissens herrscht. Deswegen ist das Gespräch die Grundlage der Erkenntnis, des Zusammenlebens, der Politik und des guten Lebens.
Schaut man sich Platons Texte jedoch genauer an, ist die Ernüchterung gross. Hier ein Beispiel aus dem Dialog Theaitetos, in dem es um die wahre Erkenntnis geht. Eben hat Theodoros Sokrates seinen Freund Theaitetos vorgestellt:
Sokrates: Theodoros sagt, [mein Gesicht] sei dem deinigen ähnlich. Jedoch wenn wir nun beide jeder eine Leier hätten und er sagte, sie wären gleichgestimmt: Würden wir ihm das sogleich glauben, oder würden wir erst untersuchen, ob er denn auch ein Tonkundiger wäre und so etwas behaupten könne?
Theaitetos: Das würden wir untersuchen.
Sokrates: Also wenn wir ihn als einen solchen erfänden, würden wir ihm glauben; wenn er aber von dieser Kunst verlassen wäre, würden wir ungläubig bleiben?
Theaitetos: Richtig.
Sokrates: Nun aber, meine ich wenigstens, wenn wir über die Ähnlichkeit unserer Gesichtszüge gewiss sein wollen, werden wir wohl zusehen müssen, ob er auch ein Maler ist und also hierüber etwas behaupten kann oder nicht.
Theaitetos: So scheint es mir.
Und so geht es immer weiter. Nicht einmal zum Stichwortgeber taugt Theaitetos, er nickt lediglich ab, was Sokrates von sich gibt. Mit einem Dialog hat das eigentlich rein gar nichts gemein. Die Dialogform soll Platon lediglich den Beweis liefern, dass die Wahrheit in jedem Einzelnen schlummert und im Gespräch hervorgeholt werden kann. Nicht zufällig war Sokrates’ Mutter Hebamme.
Der Wert des Gesprächs in der westlichen Philosophie steht in engem Zusammenhang mit der zentralen Bedeutung der Wahrheit. Darin, dass die Wahrheit das Ziel jeden Philosophierens sei, scheinen sich alle einig zu sein. Dennoch hat die Philosophie bis heute kein allgemein anerkanntes Kriterium für die Wahrheit gefunden. Selbst das traditionelle Wahrheitskriterium, die Übereinstimmung von Sache und Begriff – adaequatio intellectus ad rem –, vermag nicht zu überzeugen.
Das Bild einer Pfeife ist ebenso wenig eine Pfeife wie das Wort Pfeife. Niemand weiss genau, wie sich der Übergang von der Sache Pfeife in der Aussenwelt zur Vorstellung Pfeife im Inneren gestaltet. Dazu müsste man ja einen Aussenstandpunkt, ausserhalb der Welt der inneren Vorstellungen, einnehmen können – und diesen haben selbst Philosophierende nicht. Philosophie ist also jenes merkwürdige Unterfangen, das lediglich beweisen kann, dass sie ihr Ziel immer verfehlen wird.
Wenn kein Wahrheitskriterium den hohen Ansprüchen an Allgemeinheit und Objektivität genügt, bleibt einzig der Konsens übrig, der im Gespräch erzielt wird. Wenn zwei darin übereinstimmen, dass dies eine Pfeife sei, steigt die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass sie die Wahrheit treffen. Doch selbst der Konsens genügt auf sich allein gestellt nicht. Die Beteiligten müssen Gründe für ihren Wahrheitsanspruch angeben können, und diese liefert die Vernunft. Vernunft plus Konsens ergeben also erst zusammen eine einigermassen verlässliche Wahrheit.
Doch merkwürdigerweise trauen viele Philosophien weder dem Gespräch noch der Vernunft. Das liegt nicht nur an der Schwäche der Wahrheitskriterien, sondern auch an dem metaphysischen Gewicht der Wahrheit. Die Wahrheit wird von Platon als die Idee des Guten und Schönen bestimmt; sie ist also weit mehr als die banale Übereinstimmung von Sache (Pfeife) und Vorstellung (Bild der Pfeife). Wahrheit ist Übereinstimmung an sich, die schöne Fügung der Welt zu einem harmonischen Ganzen. Der Konsens ist deswegen auch mehr als eine oberflächliche Übereinkunft, er ist vielmehr Abbild der göttlichen Harmonie und das Gespräch sein mundaner Ausdruck.
In diesem Sinne bietet Hannah Arendt das sokratische Gespräch auch als Modell der individuellen Reflexion an:
Selbst wenn ich ganz allein leben würde, so lebte ich doch mein Leben lang im Zustand der Pluralität. Ich muss mit mir selber zurechtkommen, und nirgendwo zeigt sich dieses Ich-mit-Mir deutlicher als im abstrakten Denken, das immer ein Dialog in der Gespaltenheit, zwischen den Zweien-in-Einem ist. Der Philosoph, welcher der Grundbedingung der menschlichen Pluralität zu entkommen sucht und in die absolute Einsamkeit flieht, ist dieser jedem Menschen inhärenten Pluralität sogar noch radikaler ausgeliefert als ein anderer. Denn es ist ja das Gespräch mit anderen, das mich aus dem aufspaltenden Gespräch mit mir selbst herausreisst und mich wieder zu Einem macht – zu einem einzigen, einzigartigen Menschen, der nur mit einer Stimme spricht und von allen als ein einziger Mensch erkannt wird.
Hannah Arendt: «Sokrates. Apologie der Pluralität», Seite 57.
Ganz im Sinne der Tradition stellt auch Arendt die Gleichung auf, Gespräch gleich Konsens, Konsens gleich Einheit, und Einheit gleich Wahrheit. Auch im Sinne der Tradition fragt sie sich nicht, ob die ideale Übereinstimmung, mit sich selbst oder mit anderen, überhaupt erstrebenswert ist. Sicher ist jedenfalls, dass der Anspruch nach Harmonie nicht erfüllt werden kann.
Jedes Denken ist durch Lebenserfahrung getränkt, und weil es keine identischen Leben gibt, kann es keinen vollkommenen Konsens geben. Und das ist gut so. Nur Roboter ohne Lebensgeschichte können zu gleichen Ergebnissen kommen. Dies trifft auch auf das arendtsche Selbstgespräch zu: Nur wer eine lineare und bruchlose Lebensgeschichte hat, kann mit sich selbst übereinstimmen.
Dies ist letztlich der Grund, warum Philosophinnen dem Konsens und der Vernunft nicht getraut haben. Schon bei Plato führen Vernunft und Gespräch zwar bis zu einem bestimmten Punkt, aber das letzte Wegstück muss jeder allein zurücklegen, selbst ohne Stütze in der Vernunft. Das ändert sich über die Jahrhunderte nicht: Die Grenzen der Vernunft und des Gesprächs müssen überschritten werden, um die Wahrheit zu finden. In gewisser Weise ist die Geschichte der Philosophie die Geschichte der Versuche, ihre eigenen Grundlagen – Gespräch und Vernunft – zu überwinden.
In unserer postmetaphysischen, postreligiösen Zeit gibt es nicht einmal mehr den Ausweg einer von oben verordneten Wahrheit. Es hat den Anschein, dass wir heute mehr denn je auf das Gespräch angewiesen sind. Jürgen Habermas, Deutschlands Leitstern der Philosophie der jüngsten Jahrzehnte, forderte deshalb, das Gute müsse in einem herrschaftsfreien Diskurs ermittelt werden. Im Gespräch also. Doch im Zusammenführen von herrschaftsfrei und Diskurs liegt die Achillesferse dieser Theorie: Einen herrschaftsfreien Diskurs gibt es ebenso wenig wie einen friedlichen Krieg, denn ein Gespräch, in dem es um die Wahrheit geht, geht immer auch um Macht.
Es setzt sich nicht durch, wer recht hat, sondern es hat recht, wer sich durchsetzt. Das wusste schon Nietzsche. Das gilt für das intime Beziehungsgespräch ebenso wie für die politische Debatte, in Friedensverhandlungen ebenso wie am Familientisch. Dass das persönliche Gefühl heutzutage die Vernunft als Wahrheitsträger abgelöst hat, unterstreicht den Machtaspekt noch.
Achten Sie darauf, wie häufig in einer Debatte ein Argument oder ein Positionsbezug mit der Floskel eingeleitet wird: «Für mich ist … (es so und so).» Das ist keine Bescheidenheit, sondern das Gefühl der Übereinstimmung mit sich selbst als letztes Argument.
Der Erste, der die Nötigung zum Gespräch als Machtausübung durchschaute, war wohl Herman Melville in seiner Erzählung «Bartleby, der Schreiber». Bartleby ist Kopist in einer New Yorker Anwaltskanzlei. Seine Aufgabe besteht im handschriftlichen Kopieren der juristischen Schriftsätze. Eines Tages antwortet er auf eine kleine Bitte seines Chefs: I prefer not to, was mit lieber nicht nur unzureichend übersetzt ist. Weder weigert er sich rundheraus noch führt er den Auftrag aus, er möchte es einfach lieber nicht tun.
So geht es weiter, immer weiter. Am Ende reagiert er auf jede Bitte, auf jeden Befehl und auf jedes Flehen mit der Floskel I prefer not to. Weil Bartleby weder die Arbeit direkt verweigert noch sein Verhalten vernünftig begründet, sieht sich der Anwalt ausserstande, ihm zu kündigen. Er endet daraufhin in der Irrenanstalt. Nicht etwa Bartleby, sondern der Chef.
In der Geschichte gab es immer wieder Bewegungen, die erkannten, dass schon verloren hat, wer sich überhaupt auf das Gespräch einlässt, weil damit implizit die bestehenden Machtverhältnisse akzeptiert werden. Selbst dann, wenn man laut und aggressiv wird oder alle Fakten auf seiner Seite hat. Die Dadaisten, Surrealisten, Situationisten, Anarchisten, aber auch gewisse mystische und neomystische Strömungen versuchten deshalb, konsequent der vernünftigen Debatte auszuweichen und auf andere Weise ihre Anliegen zum Ausdruck zu bringen oder die Wahrheit zu suchen.
Das Hauptproblem besteht heute nämlich gar nicht mehr darin, in der Debatte zu unterliegen, sondern dass sie zum Selbstzweck degeneriert ist. Dass das Gespräch meist keine Handlung, keine Veränderung und keine politische Aktion einleitet, sondern sie ersetzt.
In seiner ersten Zürcher Poetikvorlesung zeigte Milo Rau auf, wie das leere Kreisen um minimale Differenzen jede politische Aktion und damit auch jede Veränderung letzten Endes unterbindet. Solange debattiert wird, können sich die Herrschenden beruhigt zurücklehnen, sie müssen nicht einmal nach Sharm al-Sheikh reisen.
Die Klimabewegung reiht sich deshalb in eine lange Tradition von Bewegungen ein, die wie Bartleby in der Gesprächsverweigerung derzeit eine ihrer stärksten politischen Waffen sehen. Die Frage ist deshalb nicht, ob es vernünftig war, van Goghs Sonnenblumen, beziehungsweise das Glas davor, mit Tomatensuppe zu bewerfen.
Die Aktion ergab zweifellos überhaupt keinen Sinn. Und genau das verleiht ihr ihre politische Kraft.