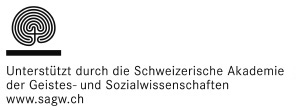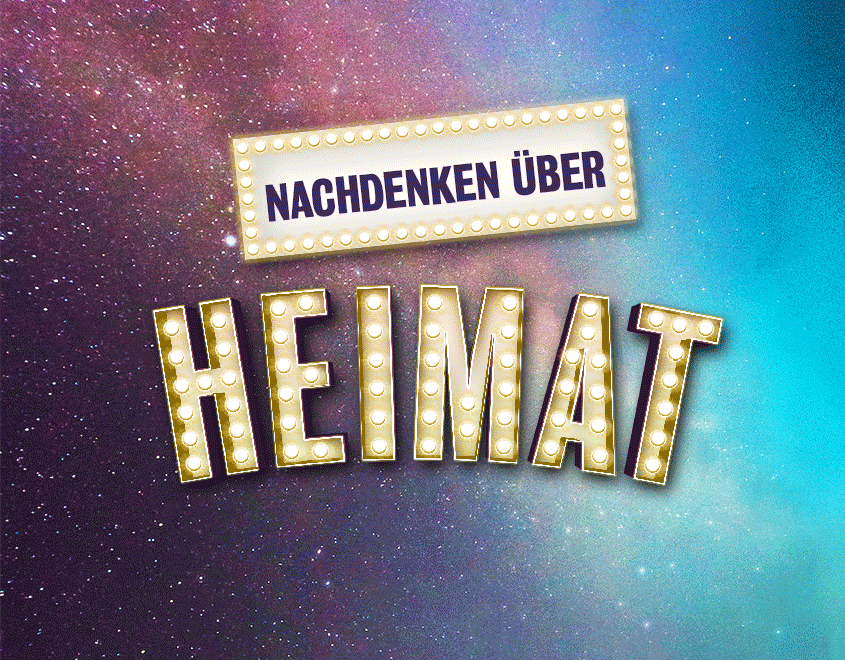Alle, alle habe ich sie gelesen, die Bände von Karl May! Nicht nur den dicken Band zu Winnetou („Schatz am Silbersee“) und Kara ben Nemsis sechs Bände zum wilden Kurdistan, sondern auch die unzähligen, langweiligen Bücher aus Mays geliebter Heimat („Radebeul“), die so ordentlich wilhelminisch reaktionär waren, so durchsetzt mit rassistischen Stereotypen, dass ich irgendwann mal erschöpft war und nicht mehr konnte, auch wenn meine Mutter die Rücken der gebundenen Bände so passend für unsere Wohnwand fand. Die Zutaten für einen romantischen Heimatbezug waren bereits in diesen ersten Lektüren da: Heimat als dort, wo jemand zu Hause ist. Laut Duden: „Land, Landesteil oder Ort, in dem man geboren und aufgewachsen ist (...), sich geborgen fühlt oder fühlte.“ Stark ist der Bezug zur Landschaft, zu den Menschen, zur eigenen Geschichte, in der Nostalgie sehr wohl ihren Platz hat. Heimat als Erinnerung und Landschaften, als Vertrautheit letztlich auch zu einer Ordnung und eines Lebensstils, die im deutschen und italienischen Teil der Schweiz besonders stark mit der Mundart abgesichert werden.
Nirgends wird die Ambivalenz der Heimat so klar wie in Edgard Reitz’ epischem Film „Heimat: eine deutsche Chronik“. Zwischen den Jahren 1919 und 1982 steht Schabbach im Hunsrück im Zentrum des Films. Es ist das Dorf der Familie Simon. Die Matriarchin, Katharina, erzählt die Geschichte des Ortes, der verschiedenen Zeitenläufe, die zu Krisen, Krieg und Wiederaufbau führen. Die Saga wird nicht von Wanderern wie Odysseus erzählt, sondern von einer Penelope, die all jene beobachtet, die wie sie bleibt. Der Holocaust findet nur am Rande statt, es gibt zwar Hinweise, das grosse Verbrechen tangiert aber das Dorfleben kaum. Heimat gibt es nur durch die Ausblendung jener Perioden unserer Geschichte, in denen Konflikte nicht zu einem guten Ende gefunden haben, sondern in Taten mündeten, die niemanden mit Stolz erfüllen (siehe hierzu das geniale Buch von Anton Kaes, ›From Hitler to Heimat: The Reform of History as Film‹, Cambridge, Mass. 1989). Vielleicht erklärt dies, warum die Nazigold-Debatte in der Schweiz in den 1990ern zu einer Mauer der Verweigerung geführt hatte.
Als Kind hatte ich die Sehnsucht, zugehörig zu sein, weniger mit der natürlichen (die war einfach da) als mit der gesellschaftlichen Umwelt. Diese Zugehörigkeit wurde aber zu einem Problem der Identität: Ich war nicht Schweizer, war ich also Italiener? Meine Eltern waren Arbeiter, italienische Arbeiter: war es diese Kategorie, die mir Heimat geben könnte, wo doch die Eltern der einheimischen Mitschüler, aus dem gleichen Milieu stammend, für Schwarzenbach stimmten. Welches ist die Mehrheit, zu der ich mich hätte zugehörig fühlen können? Kann man als Angepasster eine Heimat haben, oder wurzelt diese nicht eher im Bewusstsein zu wissen, wer man ist? Doch wie wird man wer? Was beheimatet einen?
Lange Zeit war es das Wissen. Mein Fenster zur Welt waren zunächst die Dokumentarfilme im deutschen Fernsehen, welche sich kritisch der Geschichte stellten, später wurde es die Zeitungslektüre. Das Feuilleton des damaligen Weltblatts NZZ, die gesellschaftspolitische Seite im Tages-Anzeiger, aber auch die historischen Reflexionen in der Unità und die Buchbesprechungen in der Repubblica wurden zum unendlichen Raum, in dem man am grossen Leben teilnehmen konnte. Bei uns indes an der Schule exerzierten die Lehrer Begeisterungspathos für die Armeeschau in Zürich und waren als Männer im besten Alter ergriffen, als die Tigers über unsere Dächer zischten. Da konnte man nur die Achseln zucken.
1989 war das Jahr der Umbrüche.
Eine WG-Freundin fand damals, die Schweizer Linke sei heimatlich geworden. Seit der GSoA-Initiative zur Abschaffung der Armee beschäftigten sich die Linken nur noch mit der Schweiz. In der Tat: viele jener Akteure sahen die Schweiz als Utopie, als Überwindung einer militärisch-republikanischen Ordnung, die sich auf fiktive Geschichtsbilder stützte. Im Sinne von Ernst Blochs „Prinzip Hoffnung“ sollten Vorstellungen einer möglichen neuen Lebensgestaltung in der Gesellschaft, in der bereits gelebt wird, ausprobiert werden. Die Hoffnung bestand, eine Schweiz zu bauen, die auf Gegenerfahrungen fusste und Konflikte ohne Gewalt zu adressieren. War aus Reaktion auf die diskreditierte Heimatideologie lange Zeit Links da wo keine Heimat ist, wurde bei Bloch Heimat zu einer Kategorie der Möglichkeit, der den Horizont anspricht, wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir wollen. Ernüchternd waren indes die Konflikte seit 1990, die eine neue komplexe, geopolitische Lage geschaffen haben. Die gesellschaftlichen und ökonomischen Transformationen, die Flexibilisierung der Wirtschaft und der individuellen Karrieren (inklusive Präkarisierung) haben in der Tat neue Bedingungen geschaffen, die vielen die Sicherheit und Heimat raubt, die sie zu haben glaubten.
1989 fiel auch die Mauer in Berlin und bot mir die Möglichkeit, in Potsdam wenige Jahre später an meiner Dissertation zu arbeiten. „What’s left?“ war der Titel doppelsinniger Veranstaltungen jener Zeit, die auch versuchten, politisch einen Reset zu starten und von den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Einen starken Einfluss hatte das Buch von Richard Rorty Achieving Our Country (deutsch: Stolz auf unser Land. Die amerikanische Linke und der Patriotismus, 1999). Nachdem die Linke im 20. Jahrhundert viel daran gesetzt habe, den Sozialstaat auszubauen, hätte sie dem Wiederanstieg der Ungleichheit ab Mitte der 1970er-Jahren nichts entgegenzusetzen gehabt. Es sei die auf Gesellschaftspolitik hinzielende „Neue Linke“, die das positive Verhältnis zur Nation gebrochen habe. Ohne positiven Bezug zur Nation könne indes keine gesellschaftliche Solidarität eingeklagt werden. Dies sei der Humus, auf dem der Populismus gedeihe. Allerdings: bis zu den 70er Jahren war der Ausschluss der „Ausländer“ (also jene, die nicht beheimatet werden,) Teil des helvetischen Kompromisses.
Um eine Solidarität durch Ausschluss zu verhindern wird es die Kunst unserer Generation sein müssen, Solidarität und liberale Gesellschaftspolitik zu vereinen. Im Widerstand gegen alle Formen der Entsolidarisierung, die das freie Leben bedrohen, sei es der rechtsradikale Populismus, wie auch der islamistische Terror, können neue politische Optionen und eine Entschiedenheit entstehen, welche die Errungenschaften des Verfassungsstaates verteidigen und die Menschenrechte schützen. Hier müsste die Utopie der Heimat heute lokalisiert werden. Es ist die Liebe zu den Menschen und die Stärkung der Möglichkeit, zivil miteinander umzugehen, all den Widrigkeiten zum Trotz.