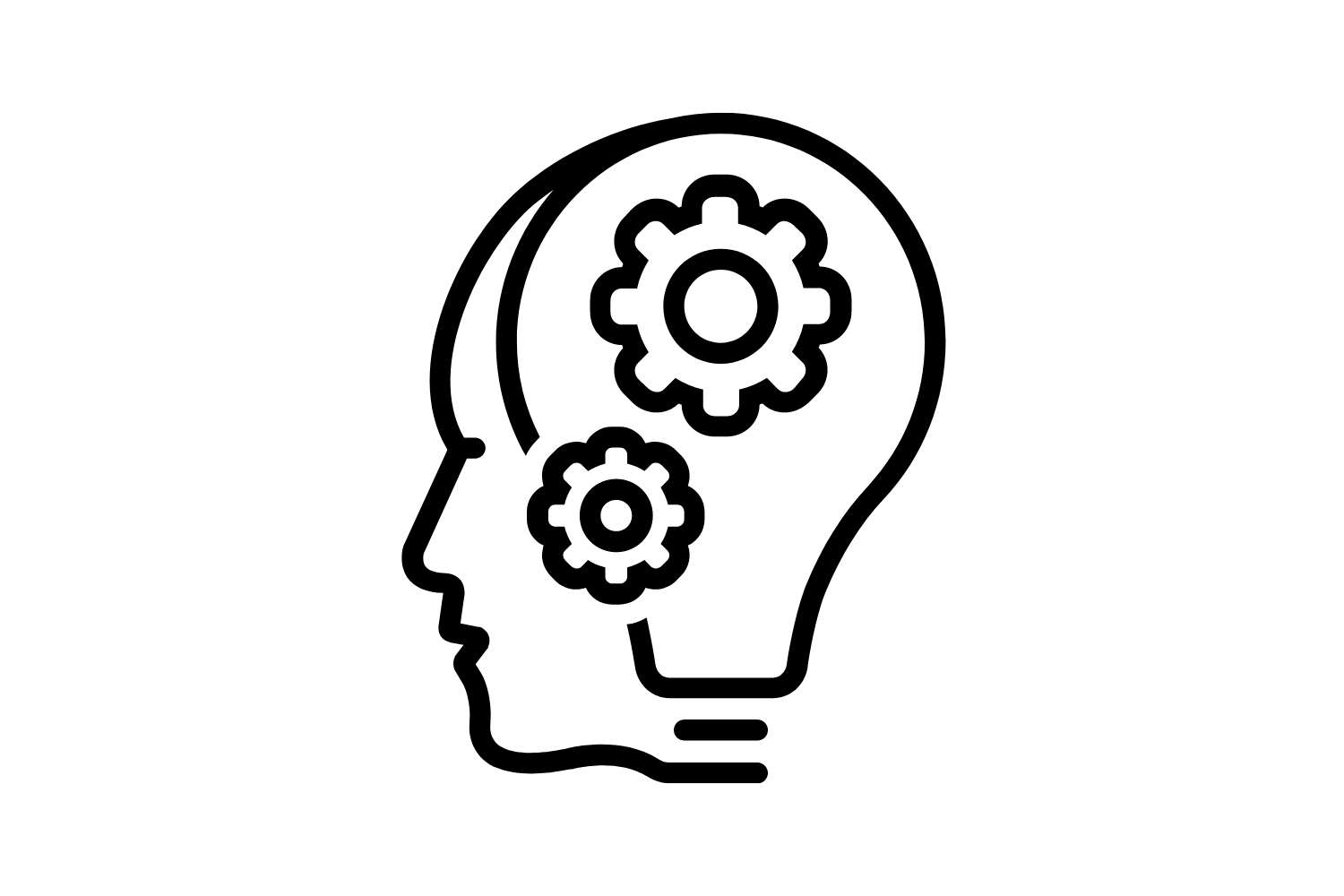Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? sind auch in der Medizin aktuelle Fragen, wenn sie auch aus naturwissenschaftlicher Perspektive und aus der Sicht des Positivismus derart einfache Antworten generieren, dass sich das Nachdenken kaum lohnt: Wissen kann ich im Prinzip alles, PubMed und verwandten Datenbanken sei Dank. Was soll ich tun? Ist eine Frage, die die Möglichkeit des Nicht-Tuns nur am Rande einbezieht und daher vor allem aus der Perspektive des Handlenden mit: Alles, was dem Patienten nicht schadet und ihm nützt, beantwortet wird. Was darf ich hoffen? wird in erster Linie optimistisch beantwortet mit dem Versprechen, dass die zu erwartenden Fortschritte eigentlich auf alles zu hoffen berechtigen.
Interessant werden diese Fragen, wenn wir überlegen: Wer fragt da, wer ist ‚ich‘? Hermann Schmitz hat überzeugend dargelegt, dass die Quelle der Gewissheit, dass es sich bei einem Ich um mich selber handelt und nicht um jemanden, der so aussieht wie ich und im Moment gerade schreibt (oder liest), auch nicht um jemanden, der von sich sagen könnte: Ich denke, also bin ich (denn woher weiss das Ich des Cogito, dass es sich um es selber handelt?) vor einer Relation auf etwas existieren muss – eine absolute Identität, die ohne Verweis auskommt. Momente, in denen diese absolute Identität aufscheint, sind Momente des heftigen affektiven Betroffenseins, z.B. im plötzlichen Erschrecken, wenn der Fuss ins Leere tritt, weil der Absatz einer Treppe noch nicht erreicht ist oder bei plötzlich den Menschen anfallendem Schmerz. In solchen Situationen wird eindeutig klar: Dies hier bin jetzt wirklich ich; Schmitz nennt dies die primitive Gegenwart (Schmitz, 2003).
Neue Phänomenologie geht von den Phänomenen aus, die im alltäglichen Erleben zugänglich sind, Schmitz geht daher häufig von konkreten Erfahrungsberichten von Einzelpersonen aus, um daraus seine weiterführenden Gedanken zu entwickeln. Die Aufgabe der Philosophie wird formuliert als: „Philosophieren ist das Nachdenken den Menschen über sein Sichfinden in seiner Umgebung“ (Schmitz, 2003; S 1). Die enge Verknüpfung philosophischer Fragestellungen mit der Lebenswelt des Menschen ermöglicht Brückenschläge zwischen Neuer Phänomenologie und Fachdisziplinen, die sich mit Menschen unter unterschiedlichen Bedingungen auseinandersetzen (z.B. Diabetologie, Psychosomatische Medizin, Unternehmensführung; Becker, 2013).
Aus den vielen Denkanstössen, die die Neue Phänomenologie bietet, scheint mir die Unterscheidung von Situation und Konstellation und die Unterscheidung von Leib und Körper für die Medizin besonders ertragreich zu sein.
Zum Unterschied von Situation und Konstellation
Während der Begriff der Konstellation ohne zusätzliche Erklärungen verständlich ist, muss der Begriff der Situation im Schmitz’schen Sinne erläutert werden: die eigene Muttersprache wird als ein typisches Beispiel für eine Situation aufgeführt, während eine Fremdsprache zumindest für den Anfänger eine Konstellation darstellt (Schmitz, 2005) : Wer eine neue Sprache erlernt, muss sich aus einzelnen Wörtern und Regeln den Satz zusammen suchen, mit dem er eine bestimmte Aussage treffen kann; dies entspricht dem Leben in Konstellationen, also der Orientierung an lauter einzelnen Regeln (Programmen). Sprechen in der Muttersprache entspricht dagegen dem Leben in Situationen, das nicht auf die Beachtung einzelner Vorschriften angewiesen ist, ja diese nicht einmal – trotz „Beherrschung“ der Sprache – alle aufzählen könnte. Die Programme werden berücksichtigt, ohne dass sie als einzelne hervortreten würden.
Den Unterschied von reichhaltiger, aber nicht vollständig explizierter Situation und überschaubarer, aus lauter Einzelheiten aufgebauter Konstellation wird auch dann deutlich, wenn man im ärztlichen Gespräch den Patienten zum einen „als Mensch“ wahrnimmt und zum anderen als Träger bestimmter Merkmale. Der Patient im Gespräch ist eine reichhaltige Situation, aus der der Arzt bei jeder Begegnung und auch bei späterem Nachdenken weitere Einzelheiten (Sachverhalte, Programme, Probleme) schöpfen kann. Der Patient ist eine Konstellation, wenn er als Träger bestimmter Eigenschaften in seinen Befunden und Diagnosen wahrgenommen wird (Großheim 2010). Gerade in der Medizin zeigt sich, dass beide Sichtweisen sich ergänzen müssen: Gerade in der Pädiatrie, wo es nicht so einfach ist, an Laborwerte und Ergebnisse Bild-gebender Verfahren zu kommen, bestimmt oft zunächst ein vager Eindruck drohenden Unheils (z.B. in Form eines ersten Eindrucks: „Dieses Kind ist krank und sollte ins Spital!“) das Geschehen. Hier schöpft die Ärztin aus der gemeinsamen Situation, die sie selber, das kranke Kind und oft ein Elternteil umfasst. Wenn es im Spital um die Frage einer adäquaten Therapie geht, müssen aus der reichen, im Einzelnen nicht explizierten Situation Einzelheiten geschöpft/expliziert werden, die sich in ihrer Summe als Befund-Konstellation im Sinne einer bestimmten Diagnose verstehen lassen. In der Chirurgie war noch vor 40 Jahren, vor Ultraschall und CT, das vage Unbehagen des erfahrenen Chirurgen Teil des Entscheidungsfindungs-Prozesses, abzuwarten oder ‚den Bauch aufzumachen‘.
Einen ähnlich gelagerten Wechsel zwischen Konstellation und Situation müssen wir bei der Vermittlung von Informationen annehmen: Der Wunsch der Patienten, vollständig informiert zu werden, die gleichsinnige Forderung in Gesundheitspolitik und Öffentlichkeit nach Arzt-Patient-Beziehung als Partnerschaft, kontrastiert mit dem limitierten Auffassungsvermögen des Menschen, der bestenfalls 7 einzelne und 16 thematisch gegliederte (vier Informationen in vier Kategorien) Informationen behalten kann (Langewitz et al., 2015; Mathy & Feldman, 2012). Vollständiges Informieren generiert jenseits der Grenze von sieben Einzelinformationen keine zunehmend komplexere Konstellation, sondern eine Situation, in die die vielen einzelnen Inhalte im chaotisch Mannigfaltigen untertauchen. Die Lebenssituation des Patienten, seine persönliche Art, Entscheidungen zu fällen, leitet den Prozess des ‚Schöpfens von Einzelheiten‘ aus der reichen Situation, z.B. im Sinne von: „Ich weiss auch nicht genau, wie die Ärztin das machen wird, aber die weiss, wovon sie spricht. Ich vertraue ihr.“
Leib und Körper
- Arzt (Vor sich die Akten des Patienten): „Na, wie geht es Ihnen denn?“
- Patient (denkt kurz nach): „Gut, ich fühl‘ mich gut.“
- Arzt (blättert zurück zu den Laborbefunden): „Stimmt!“
Hier wird deutlich, dass Patient und Arzt sich in unterschiedlichen Bereichen orientieren, der Patient sucht die Antwort im eigenleiblichen Spüren , bei dem er etwas wiedergeben könnte, was er vielleicht mit ‚ziemlich ausgeruht, nicht nervös, im vollen Besitz meiner Kräfte‘, etc. beschreiben könnte, während der Arzt in den Befunden sucht, die den physiologisch-anatomischen Körper des Patienten charakterisieren. Typisch für das Wahrnehmen leiblicher Regungen ist die Unmöglichkeit einer präzisen Lokalisation an relativem Ort: in vollem Besitz meiner Kräfte, oder Sorgen („etwas stimmt nicht mit mir!“) sind in cm Abstand z.B. zum Rippenbogen nicht anzugeben. Körperliche Phänomene (z.B. Petechien, Gelenkerguss) dagegen können mit Hilfe der Sinne, i.d.R. Tasten und Sehen – und ihren technischen Hilfsmitteln wie Ultraschall und Röntgen - sehr wohl präzise lokalisiert werden.
In der Medizin sind wir, abgesehen von einem akuten Unfallereignis, eigentlich immer mit Mischbildern aus eigenleiblichem Spüren und körperlichen Befunden im Kontakt, die nur schlecht miteinander korrelieren. Screening –Programmen werden propagiert, weil sich im eigenleiblichen Spüren das Colon-Carcinom nicht abbildet, es muss auf der Ebene körperlicher Veränderungen identifiziert werden.
Interaktion auf leiblicher Ebene sind aus der Perspektive der Neuen Phänomenologie die Basis für die Fähigkeit des Menschen, sich in eine andere Person hineinzuversetzen, für die sogenannte Empathie. Wechselseitige Einleibung in ihren verschiedenen Ausprägungen ermöglicht gemeinsames Singen in solidarischer Einleibung, die Manipulation von Menschenmassen, die untereinander solidarisch und auf einen Anführer hin antagonistisch ‚eingeleibt‘ sind (Schmitz 1999). Wechselseitige Einleibung die Bereitschaft, sich von der leiblichen Befindlichkeit des Gegenübers affizieren zu lassen, ist die Basis für das Gespür einer Pädiaterin, die drohende Gefahr ‚wittert‘ und ein Kind auch ohne Laborbefund oder Röntgenbild abends noch einmal besucht oder in eine Spitalambulanz einweist. Zu viel wechselseitige Einleibung kann gefährlich werden, wenn z.B. die Angst des Patienten den handelnden Arzt affiziert; von daher schützen Abdecktücher nicht nur vor einer Keimübertragung, sondern auch vor einer Gefühls-Übertragung, vor allem, wenn sie den Blick des Patienten als Brücke der Einleibung abschirmen.
- Großheim 2010: Von der Maigret-Kultur zur Sherlock Holmes-Kultur. Oder: Der phänomenologische Situationsbegriff als Grundlage einer Kulturkritik. In: M. Großheim & S. Kluck Hrsg.), Phänomenologie und Kulturkritik. Freiburg/München: Alber Verlag, 52-84
- Langewitz et al.; Improving patient recall of information – harnessing the power of structure. Lat Educ Couns 2015; 716-721
- Mathy F. und Feldman J: What’s magic about magic numbers? Chunking and data compression in short-term memory. . Cognition 122 (2012) 346–362
- Schmitz H.: Adolf Hitler in der Geschichte. Bouvier Verlag 1999
- Hermann Schmitz: Was ist Neue Phänomenologie; Ingo Koch Verlag, Rostock, 2003
- Hermann Schmitz, Situationen und Konstellationen, Karl Alber Verlag, Freiburg/München; 2005
- Heinz Becker, Hrsg.: Zugang zu Menschen; Verlag Karl Alber, Freiburg/München, 2013