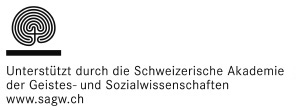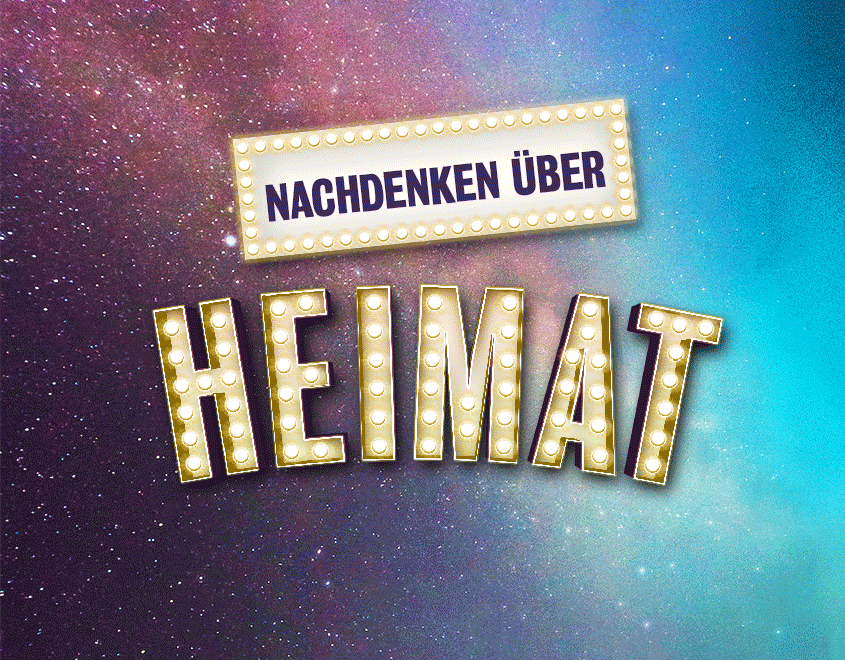Als Christoph Kolumbus auf dem amerikanischen Kontinent anlangte, fand er dort Menschen vor, die das neu entdeckte Land bewohnten. Lassen wir einmal alles beiseite, was die normative Bewertung dieser Situation erschweren könnte, und fragen wir danach, wie wir Ansprüche auf das Land beurteilen würden. Grundsätzlich scheint klar zu sein: Die heimischen Indianer haben ein Vorrecht auf die Nutzung und Gestaltung des Landes, das sie bewohnen. Wenn Fremde das Land besiedeln möchten, so dürfen sie das nicht ohne weiteres tun. Sie müssen entweder das Einverständnis der Einheimischen einholen oder außergewöhnliche Umstände geltend machen. In irgendeinem Sinn ‚gehört‘ den Einheimischen das Land – natürlich nicht im gleichen Sinn, wie mir mein Auto oder ein Schokoladenriegel gehört, aber doch in einer analogen Weise. Warum ist das so?
Eine philosophische Theorie zu dieser Frage muss angeben, worin solche Ansprüche begründet liegen. Sie sollte damit nicht nur einfache Fälle wie den des Kolumbus-Beispiels erklären können, sondern auch dazu beitragen, in komplizierteren Fällen eine Lösung zu finden, in denen darüber gestritten wird, welche konkreten Rechte mit Ansprüchen auf ein Territorium verbunden sind oder welche Partei einen Anspruch auf ein Territorium geltend machen kann, wenn es Streit über diese Frage gibt.
Doch bleiben wir bei Kolumbus. Eine auf den ersten Blick einleuchtende Antwort auf die aufgeworfene Frage lautet: „Das Land gehört den Indianern, weil sie zuerst da waren.“ Hält diese Antwort einer näheren Überprüfung stand?
Wenn tatsächlich die zeitliche Dimension der Besiedelung entscheidend wäre, hätte Kolumbus nicht klar sein können, ob er legitime Bewohner des Landes vor sich hat oder nicht. Denn die Vorfahren der Indianer haben möglicherweise, als sie in das Land eingewandert sind, andere Völker vertrieben oder sich mit anderen Völkern vermischt. Das Kriterium des Zuerst-dagewesen-Seins würde den Nachweis nötig machen, dass ein Volk tatsächlich der Erstbesitzer eines Territoriums ist oder aber das Territorium vom Erstbesitzer durch eine Kette von legitimen Übertragungen übernommen hat. Es hätte Kolumbus daher schwer fallen müssen, ein Urteil über Besitzansprüche zu fällen, und die Indianer hätten womöglich schlechte Karten gehabt, ihre Ansprüche zweifelsfrei zu belegen. Diese Konsequenz ist unplausibel.
Viele Theoretiker schlagen daher andere Erklärungen für das Vorliegen von Territorialansprüchen vor. Einer der wichtigsten Vorschläge benutzt den Begriff der Heimat. Demnach hatten die Indianer ein Vorrecht auf das Territorium Amerikas, weil dieses Territorium ihre Heimat war. Volk und Territorium stehen nach dieser Position in einem Wechselverhältnis: Einerseits hat das Volk sein Heimatland geprägt, eine typische Architektur entwickeln, Gebäude errichtet, eine Infrastruktur aufgebaut. Andererseits wirkt das Heimatland in den kulturellen Bestand des Volkes hinein: In den Mythen und Geschichtserzählungen des Volkes spielen konkrete Orte eine Rolle; das Klima und die Landschaft bestimmen kulturelle Entwicklungen und das geteilte Wertbewusstsein. Kurzum, es gibt eine besondere Bindung eines Volkes an sein Heimatland.
Diese Theorie kann das Kolumbus-Beispiel besser erklären. Ohne dass Kolumbus Nachforschungen über mögliche Vorbesitzer des Landes anstellen musste, konnte er sehen, dass die Einheimischen mit dem Land eng verbunden waren. Dass Teile des Landes den Indianern sogar als heilig galten, ist nur eine besonders ausgeprägte Form dieser engen Bindung – in der philosophischen Debatte sind die heiligen Berge der Sioux-Indianer ein beliebtes Beispiel, um solche Bindungen zu illustrieren. Auch heutige Konflikte um Territorien kann die Theorie erklären. Man denke etwa an Israel, wo zwei verschiedene Bevölkerungsgruppen genau solche engen Bindungen an ein Territorium geltend machen.
Ob man die Theorie nun für die beste hält oder nicht – es lohnt sich, nach den Konsequenzen zu fragen, die sie mit sich brächte. Es fällt auf, dass die Theorie die oben genannte Analogie mit Eigentumsansprüchen weitgehend aufgibt, denn es geht hier nicht mehr um Ersterwerb und Eigentumsübertragung. Streng genommen gibt es bei Territorialansprüchen nach dieser Theorie gar kein klares „x gehört y“, sondern nur einen besonderen Anspruch, der graduell mit der Dichte der Bindung stärker wird. Dieser Anspruch ist noch nicht mit einem Recht auf das Territorium gleichzusetzen, sondern kann von anderen Ansprüchen überwogen werden.
Dann wird aber unklar, ob es nach dieser Theorie ein willkürliches Verfügungsrecht über das Territorium geben kann, das etwa den Ausschluss von Einwanderungswilligen umfasst – kann allein die Tatsache, dass eine enge Bindung besteht, ein solches Recht begründen? Zumindest impliziert die Theorie, dass es eine starke Asymmetrie gibt zwischen dem Anspruch, nicht vertrieben zu werden, und dem Anspruch, das Territorium für Einwanderungswillige zu schließen. Während eine enge Bindung an das Heimatland zu einem Recht in einem strengen Sinn führen dürfte, nicht aus seiner Heimat vertrieben zu werden, ist es schwierig zu zeigen, weshalb niemand zusätzlich einwandern dürfen sollte. Ein Indianer kann einen Berg auch dann als heilig verehren, wenn sein eingewanderter Nachbar das nicht tut.
Es ist übertrieben zu behaupten, dass die Theorie der Bindung zwischen Territorium und Bewohnern gar keine Gründe an die Hand gibt, Einwanderung zu begrenzen. Extrem hohe Einwanderungsraten könnten dazu führen, dass das Territorium seinen Charakter verändert, die typische Lebensart der Einheimischen nicht mehr zulässt. Wenn im Indianer-Beispiel die eigenwanderten Nachbarn irgendwann die Mehrheit bilden und im heiligen Gelände Bergbau betreiben, ist die enge Bindung zwischen Territorium und den Eingeborenen zerstört.
Natürlich ist es schwer, klare Grenzen zu definieren, ab wann Einwanderung für die Bindung zwischen Volk und Territorium bedrohlich wird. Aber es dürfte klar geworden sein, dass das Argument der kulturellen Bindung keine herausragenden Ansprüche begründen kann, die andere Interessen so gut wie immer überwiegen. Dass diese Schlussfolgerung, die wir aus Überlegungen zu einem einfachen Beispiel gewonnen haben, für die gegenwärtigen Debatten um den Heimatbegriff im Kontext großer Migrationsströme nicht folgenlos ist, dürfte auf der Hand liegen.
Weiterführende Literatur:
Ypi, Lea 2013: Territorial Rights and Exclusion, Philosophy Compass 8, 241-253
Miller, David 2017: Immigration und territoriale Rechte, in: Frank Dietrich (Hg.): Ethik der Migration, Suhrkamp: Berlin 2017, 77-97
Hoesch, Matthias 2016: Allgemeine Hilfspflicht, territoriale Gerechtigkeit und Wiedergutmachung: Drei Kriterien für eine faire Verteilung von Flüchtlingen – und wann sie irrelevant werden, in: Thomas Grundmann/Achim Stephan (Hg.): Welche und wie viele Flüchtlinge sollen wir aufnehmen? Stuttgart: Reclam 2016, 15–29