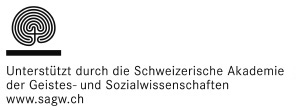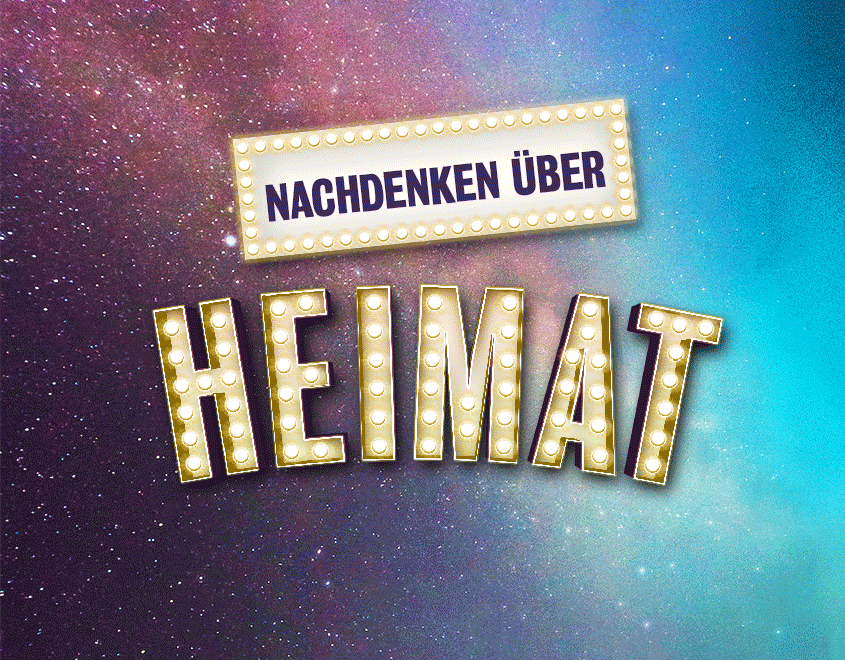UNA VITA IN SCATOLA – LEBEN IN EINER SCHACHTEL lautet der Titel eines wunderbaren Zeichentrickfilms von Bruno Bozzetto aus dem Jahr 1967. Knapp sieben Minuten reichen dabei vollkommen aus, ein ganzes Leben auf die Leinwand zu bringen. Und wer dieses Kunstwerk heute auf sich wirken lässt, sieht sich plötzlich mit der Frage konfrontiert: Und ich selbst? Wie bin ich im Leben beheimatet?
Bei Bozzetto lässt der Alltag kaum Raum, sich zu existentiellen Höhenflügen aufzuschwingen – der Künstler erfindet dafür das Bild der verschachtelten Existenz. Er zeichnet nach, wie sich menschliches Hin- und Her zumeist zwischen grauen Schachteln – Schule, Universität, Arbeitsstelle, Krankenhaus und Wohnung – bewegt. Schon nach den ersten Szenen wird deutlich: Für die Titelfigur beschleunigt sich ihr Lebenslauf – von der Wiege bis zur Bahre – immer stärker. Die Abstände zwischen den Schachteln – Spielräume der Freiheit und des Lebens – schnurren sekundenschnell zusammen. Zum Schluss bleibt gar kein Platz mehr. Am Ende zwingt die unerbittliche Zeit alles auf einen Punkt zusammen. Ist das also eine traurige Geschichte zum Thema: Wir haben hier keine bleibende Heimat?
Die große Kunst des Regisseurs besteht darin, in einer grauen, monochromen Welt Momente von Freude und Glück, Freiheit und Farbigkeit aufleuchten zu lassen – etwa wenn sein rasender Protagonist als Schüler auf dem Heimweg ins Träumen gerät und die Welt kurzerhand zu blühen beginnt. Aber Fabriksirenen zwingen den Staunenden in den Alltag zurück. Dort gilt es, immer stärker zu beschleunigen, um mithalten zu können. Es sind aber gerade solche Traumsequenzen, in denen das Tempo des Lebensfilms für einen Augenblick zum Stillstand kommt. Wo ist in der Schachtel-Welt menschliche Beheimatung spürbar? Beim Anblick einer blühenden Landschaft, bei der ersten Liebe und bei der Geburt eines Kindes. Sie vermitteln dem Zuschauer eine Ahnung davon, was es heißt: Leben ist mehr als ein Wettlauf mit der unerbittlichen Zeit.
„Ja, renn nur nach dem Glück / doch renne nicht zu sehr! / Denn alle rennen nach dem Glück / Das Glück rennt hinterher. / Denn für dieses Leben / ist der Mensch nicht anspruchslos genug / drum ist all sein Streben / nur ein Selbstbetrug.“, so verdichtet Bertolt Brecht seine urbane Erfahrung in der Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Planens. Dieser Song aus der Dreigroschenoper wurde in den 1920er Jahren uraufgeführt, als das ruhelose Berlin dabei war, sich zur Weltstadt zu entwickeln – zu Beginn jener Zeitenwende, die begann, gewaltige Energie- und Verkehrsmassen zu mobilisieren. Da klingt der große Agnostiker B.B. mit einem Mal wie ein spiritueler Klassiker, wenn er – fast wie der Kirchenlehrer Augustinus – zu bedenken gibt: Das Herz des Menschen ist nicht durch ständiges Rennen zu beruhigen. Und Martin Heidegger, der der Mobilisierungs-Epoche in Sein und Zeit einen Spiegel vorhält, spricht vom Tummelplatz des „Man“, zu dem die Menschen massenweise hindrängen, paradoxerweise von der Angst ums eigene Ich angetrieben.
Ist es da nicht wie in UNA VITA IN SCATOLA eine befreiende Aufforderung, Abstand zu gewinnen und darauf zu achten, wie das In-der-Welt-Sein und die Zeit tatsächlich zusammenhängen? In Bozzettos kunstvollem kleinem Film sind es Augenblicke des Staunens, der Ruhe und Selbstvergessenheit, in denen Fülle mit Händen zu greifen ist.