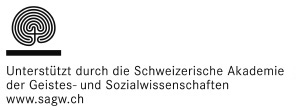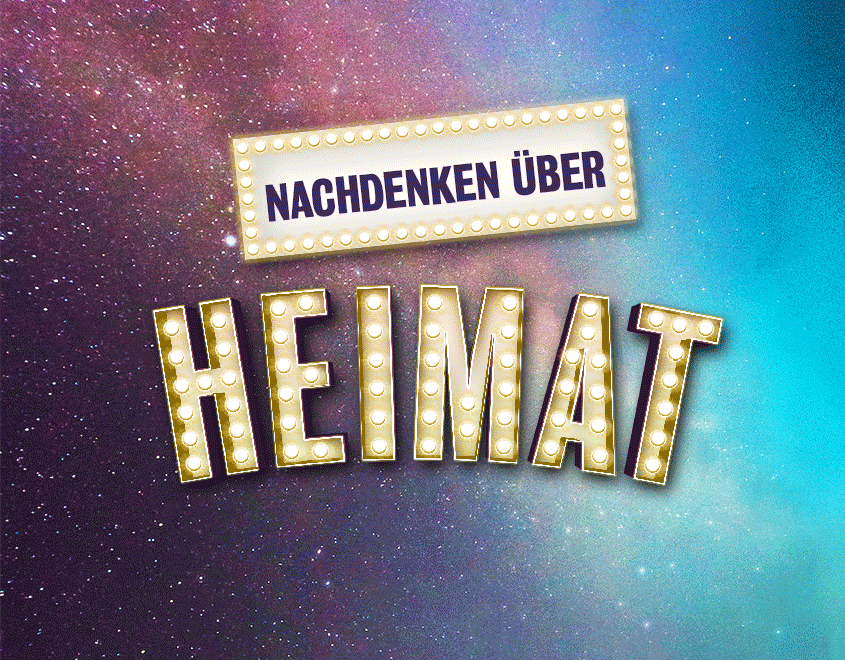Zehn Jahre war Odysseus fern der Heimat. Im Heer des Agamemnon kämpfte er vor Troja. Und als der Krieg zuletzt dank seiner List gewonnen war, da brauchte er erneut zehn Jahre für den langen und gefahrenreichen Heimweg. Die Odyssee des Helden führte kreuz und quer durchs Mittelmeer – vorbei an Klippen und Sirenen, Zyklopen oder Lotophagen. Dem allen aber hielt er stand, getrieben von der einen großen Sehnsucht: dem Wunsch zuletzt nach Haus zu kommen – zu Frau und Kind und Haus und Hof.
Man könnte diesen Drang nach Heimat spießig finden. Man könnte fragen, ob Odysseus nicht der Antityp zum Abenteurer ist, zu jenem selbstbewussten, mutigen Subjekt, das sich der Wertschätzung des Zeitgeistes gewiss sein darf, wo es den Aufbruch wagt, um fern der Heimat neue Welten zu erobern; das seine Freiheit darin findet, sich in unbekannte Zonen vorzuwagen. So etwa sah es Theodor Adorno, der in seinem – gemeinsam mit Max Horkheimer verfassten – Meisterwerk zur „Dialektik der Aufklärung“ Odysseus als das „Urbild des bürgerlichen Individuums“ deutete. Der Held des Epos, so die These, sei ein Vorfahr des modernen Homo Faber, der sich mit List und Verve eine Heimat schafft, um den Gefährdungen des nackten, wilden Lebens zu entrinnen. Die Heimat, die Odysseus sucht, sei aber eine falsche, hergestellte Heimat, die stets erkauft wird durch den Preis der Selbstverleugnung: der Selbstentfremdung von der eigenen Natur.
Fetisch der Faschisten
So mögen neuzeitliche Denker denken. Zumal wenn sie, wie Horkheimer oder Adorno, erleben musste, in welch fürchterlichem Maße das Konzept der Heimat ideologisch ausgeschlachtet wurde. Dass nach dem Rausch von „Heim ins Reich“ und all der Blut-und-Boden-Propaganda des Faschismus ein so unscheinbares Wort wie Heimat nicht mehr umstandslos verwendet werden konnte, dürfte außer Frage stehen. Doch ob man ihm damit gerecht wird, es zum Fetisch des modernen bürgerlichen Subjekts umzudeuten, das die giftige Ideologie des Nationalsozialismus hervorbrachtet – das muss man in Frage stellen. Vor allem weil stigmatisierte Worte dazu neigen, sich in Gespenster zu verwandeln, die von Ideologen jederzeit heraufbeschworen werden können, um mit ihnen Schindluder zu treiben. Heimat ist so ein Konzept, wie die neue Rechte in Europa eindrücklich beweist.
Was aber mochte ein Odysseus denken, als er sich nach Heimkunft sehnte? Was löste dieses Wort im Kopfe jener Griechen aus, die es für eine schwere Strafe hielten, fern der Heimat ihre Tage zu verbringen? Die Heimat war für sie der Ort der Freiheit. Eleutheros – frei – konnte nur ein Mensch sein, der lebte, wo er hingehörte. Und er gehörte dorthin, wo er Menschen fand, denen er sich zugehörig wusste. Heimat, so tönt es aus den alten Texten, ist ein Ort der Zugehörigkeit.
Raum des Gedeihens
Das Wort verrät, worum es bei dem Stichwort Heimat wirklich geht: Es geht ums Hören. Und damit geht es um die Sprache. Und mit der Sprache geht es um das Element, worin wir Menschen wachsen und gedeihen können. „Die Sprache ist das Haus des Seins“, bemerkte Martin Heidegger. Und wenn man diesen Gedanken mit Hans-Georg Gadamer auf die menschliche Lebenswelt anwendet, lässt sich sagen: Der Sprachraum ist der Raum der Selbstentfaltung unseres eigenen Seins – der Raum, der es uns erlaubt, in Freiheit unserer Potenziale zu entfalten, gerade weil wir in ihm mit anderen verbunden sind; weil wir uns in ihm Gehör verschaffen können, weil wir in ihm hören können, was uns die Menschen und die Welt zu sagen haben.
Heimat – im recht verstandenen Sinne des Wortes – ist mithin immer dort, wo man die gleiche Sprache spricht. Wobei der Satz Gefahr läuft, oberflächlich ausgelegt zu werden. Denn eine Sprache sprechen heißt weit mehr, als man gemeinhin annimmt: Es heißt nicht einfach nur, Informationen auszutauschen. Die Sprache ist nicht einfach nur ein Werkzeug oder ein Transportmittel für Daten. In Wahrheit ist sie Poesie. Sie ist ein Ausdruck der Lebendigkeit, ist ein Naturgeschehen, ist ein Wachsen und Gedeihen, ein individuelles Sich-Ausdrücken und Zeigen in der Welt. Sie ist das Element, worin der Mensch zu dem wird, was er ist und was er sein kann.
Das Heimweh endet nie
Sofern wie sprechen, sind wir freilich nie allein. Die Sprache ist ein Spiel, das zwischen Menschen oder zwischen Mensch und Dingen spielt. Und dieses Spiel verfolgt ein klares Ziel. Es heißt Verständigung. Bei allem Sprechen ringen wir um Einverständnis. Wir wollen einverstanden sein – mit uns, mit anderen, mit der Welt. Und deshalb ist es uns so wichtig, das Gehör der anderen zu finden. Deshalb ist uns so wichtig, andere zu hören, die dieselbe Sprache sprechen wie wir selbst. Deshalb ist uns so wichtig, dort zu weilen, wo wir uns zugehörig wissen. Deshalb erlischt die Sehnsucht nach der Heimat nie. Es war die blanke Wahrheit, als einst Novalis verkündete, Philosophie sei gar nichts anderes als Heimweh – weil sie die Sehnsucht nach Verstehen ist, die niemals endgültig zur Ruhe kommt.
Heimat ist da, wo wir verstanden werden und verstehen. Heimat ist da, wo Einverständnis herrscht. Sie ist nicht hinter Grenzen oder Mauern. Sie ist nicht da, wo man besitzt oder sich sicher fühlt. Sie ist an keinen festen Ort gebunden, sondern an ein nicht endendes Gespräch. Heimat ist nur, wo wir immer neu bereit sind zuzuhören und wo man uns Gehör schenkt. Heimat ist nur, wo wir immer neu bereit sind, anderen zu antworten und die Verantwortung für andere zu übernehmen wagen. Heimat muss immer neu errungen worden. Wer glaubt, er könne sie fixieren oder herstellen, erliegt der Illusion des Homo Faber. Heimat wird nie gemacht, sondern wird immer nur gefunden. Wer anderes behauptet, redet nicht von Heimat, sondern einer Fliehburg, die ihn von sich und anderen entfremdet – und ihn zuletzt um die Lebendigkeit eines menschlichen Lebens betrügt.
Wer die Odyssee mit den Ohren eines alten Griechen hört, versteht sogleich, dass es dem Helden nie um Sicherheit, Besitz und bürgerliche Ruhe geht; und dass Homer als Dichter nicht für die neuzeitliche Selbstbehauptung gegenüber der Natur warb und an ihrer Stelle die artifizielle Heimat des Homo Faber stellte. Nein, es ging ihm darum, des Menschen Sehnsucht nach dem freien, echten Leben zu besingen, das nur gedeihen kann, wo man zuhause ist. Es ging darum, ein Denkmal auf die Treue zur Natur und die Verbundenheit mit Menschen zu setzen; im Wissen darum, dass das Leben nur erblüht, wo es im heimatlichen Raum der Sprache wächst.