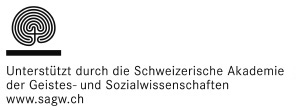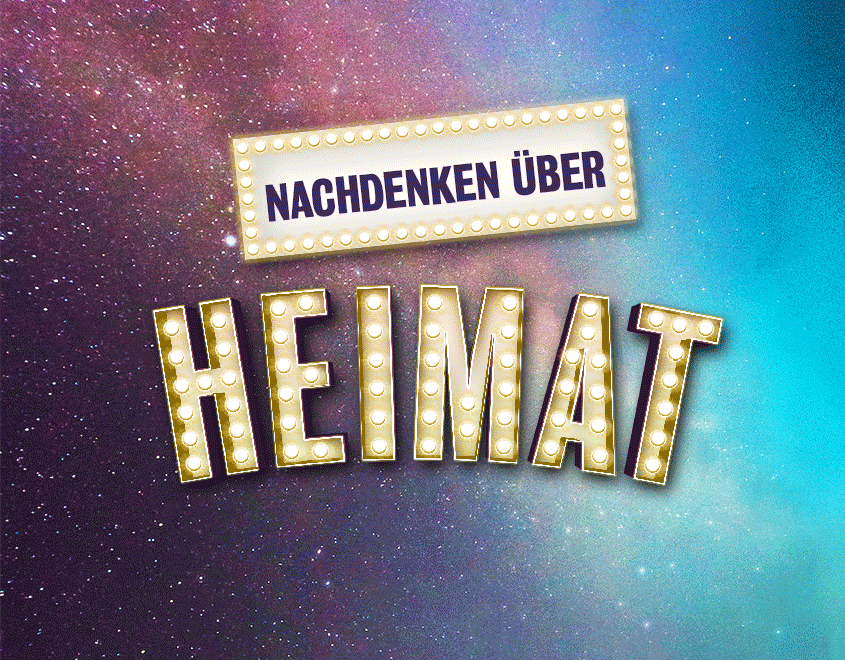So Friedrich Hölderlin in seiner großen Hymne „Der Rhein“, in der er den Flusslauf des Rheins als Lebenslauf beschreibt, besser: besingt, als den Lebenslauf eines Halbgotts. Aber gilt nicht auch für uns Menschen, was für diesen gilt? Das Datum der Geburt stellt uns in eine geschichtliche Situation hinein, der Ort der Geburt, der uns in eine Stadt, in eine Region, in eine Nation bringt, und die Familie, die uns empfängt, all dies bestimmt unser Leben ganz und gar, mögen wir später auch noch so eigenwillige Wege gehen. Was wäre aus mir geworden, wenn ich 20 Jahre früher als Tscheche geboren worden wäre oder 20 Jahre später als Franzose? Jedenfalls etwas ganz anderes als das, was ich nun geworden bin als Deutscher aus Rheinhessen.
Die Stelle aus Hölderlins Hymne „Der Rhein“ zitiert der Philosoph Martin Heidegger in seiner Tischrede zur Primiz, zur ersten Messfeier seines Neffen Heinrich Heidegger am Pfingstsonntag des Jahres 1954. Das meiste vermag die Geburt: Martin Heidegger stammte aus einer frommen katholischen Familie aus dem südbadischen Meßkirch, der Vater war Küster der Martinskirche, der Sohn studierte katholische Theologie in Freiburg und wollte Priester werden, nahm aber dann das Studium der Philosophie auf und entfernte sich von der katholischen Kirche, deren enge Auffassung von Philosophie ihn bedrückte. Er musste sich aus ihr lösen, um seine eigene Position zu finden. Behilflich war ihm dabei auch die evangelische Theologie, die ihm in Marburg, wo er seine erste Professur erhielt, in Gestalt seines Freundes Rudolf Bultmann begegnete. Seine Abwendung vom Katholischen war so schroff, dass er sich verschiedentlich geringschätzig über die katholischen Kollegen in Freiburg äußerte, wohin er dann berufen wurde, ja, den Lebensweg katholischer Kandidaten in der Nazizeit regelrecht behinderte, indem er sie in Gutachten als katholisch und nichts als das abstempelte, sie also den Nazis verdächtig machte.
Die viel kritisierte Sympathie für den Nationalsozialismus im kurzen Jahr seines Rektorats an der Universität Freiburg von 1933 auf 34 hatte auch mit seine Abkehr von der katholischen Kirche zu tun. Wäre er katholisch geblieben wie sein Bruder Fritz, der wie die meisten Katholiken immer brav das katholische Zentrum wählte, wäre er nicht auf den Nationalsozialismus hereingefallen, der ihm einen endgültigen Abschied von der engen Welt Meßkirchs zu ermöglichen schien. Merkwürdigerweise war der Bruder, ein Bankbeamter, der sein Leben lang in Meßkirch blieb, in dieser Hinsicht klüger als der Philosoph in Freiburg, der sich von Meßkirch schroff abgewandt hatte.
Die Herkunft legt uns fest, aber sie kann auch in Maßen überwunden werden, ja, sie muss in manchen Fällen überwunden werden, damit wir zu unserem Eigenen kommen. Das muss nicht bedeuten, dass wir den heimatlichen Ort verlassen, es geht um eine innere Befreiung, die ein Wegzug erleichtern wird, aber nicht garantiert. Diese innere oder äußere Entfernung von der Herkunft kann auch zu Irrtum und Fehlern führen, wie das Beispiel des Philosophen zeigt. Der Ertrag in seinem Fall, der einer großen Philosophie, die über die katholische Scholastik hinausführt, ist aber auch erheblich.
So wie hier, so auch sonst: wir brauchen einen Ursprung, aber wir müssen uns auch von ihm unter Umständen entfernen können, um uns zu entwickeln zu mehr als zu dem, was wir an diesem Ursprung geblieben wären. Das kann auch schmerzhaft sein, das kann auch fehlerhaft sein. Im Grunde geht es darum, dass wir all das, was von Anfang an in uns angelegt ist, aus uns heraus entfalten. Das, was ich bin, soll ich werden. Unser Leben kann sich so wie in einem Bogen vollziehen, auch dies sah Hölderlin: in Progress und Regress, wie er sagt. Wir gehen von zu Hause weg, hinaus in die Welt, wie man das früher nannte, und kehren nach mancherlei Erfahrungen wieder nach Hause zurück. So wenig wie das „Weggehen“ bedeuten muss, dass wir tatsächlich weggehen, so wenig muss die „Rückkehr“ bedeuten, dass wir tatsächlich zurückkehren. Wir müssen nicht wieder am Ort unserer Geburt sesshaft werden, wir können uns auch in Gedanken und Erinnerungen wieder diesem Ort annähern, eine im Alter nicht seltene Bewegung.
So auch bei Heidegger, der schon im Krieg die Familie in Meßkirch als einzige Stütze fand, als er den Mitarbeitern an der Universität nicht mehr trauen wollte. Seine Manuskripte brachte er nach Meßkirch, wo sie der fromme Bruder Fritz bei einem katholischen Pfarrer barg, der sie ausgerechnet im Kirchturm versteckte. wo sie den Krieg überdauerten. Und nach dem Krieg kam Martin oft und gerne nach Meßkirch und von dort pilgerte er mit dem Bruder auch wieder nach Kloster Beuron, um seinen Namenstag zu feiern.
Heidegger in jener Tischrede von 1954: „Das meiste an natürlichen Gaben bringt die heimatliche Erde und der Himmel über ihr. Aus ihnen gedeiht Jenes, das stark genug ist, dem Geschenk der Gnade entgegenzuwachsen.“ Himmel und Erde, auch dies eine Konstellation Hölderlins: der Lichtstrahl, der dem Neugeborenen begegnet, kommt von oben. Hier ist der Mensch zwischen Himmel und Erde gespannt, zwischen Diesseits und Jenseits. Und es gilt, der Gnade, wie Martin Heidegger sagt, „entgegenzuwachsen“. Der Ursprung ist festgelegt, aber wir müssen noch wachsen, der Gnade entgegen wachsen. Auch dies heißt ja, dass vieles, was wir später in unserem Leben bewirken, nicht unbedingt unser Werk ist. Manches wird uns geschenkt oder auch auferlegt.
„Die Heimat ist das Land der Kindheit“, schreibt der große tschechische Schriftsteller Karel Capek, „das Land der ersten und darum auch stärksten Eindrücke, Entdeckungen und Erkenntnisse. Man braucht nicht dorthin zurückzukehren, denn eigentlich hört man nicht auf, dort zu leben, wo immer man sein mag. Die Heimat ist wie die Muttersprache, auch wenn jemand eine andere Sprache spricht oder schreibt, hört er doch nicht auf, in der Sprache seiner Kindheit zu denken und zu träumen. Das ist nicht Einfluss, sondern etwas Ursprünglicheres und Stärkeres: das ist ein Stück der eigenen Seele und Persönlichkeit.“
[...]
Dies ist der erste Teil des Aufsatzes
„Wohnen bedeutet, an einem bestimmten Ort zu Hause zu sein“. Der Ort als Heimat,
erschienen in: Annika Schlitte (Hrsg.): Philosophie des Ortes. Reflexionen zum Spatial Turn in den Sozial- und Kulturwissenschaften. transcript (Bielefeld) 2014.