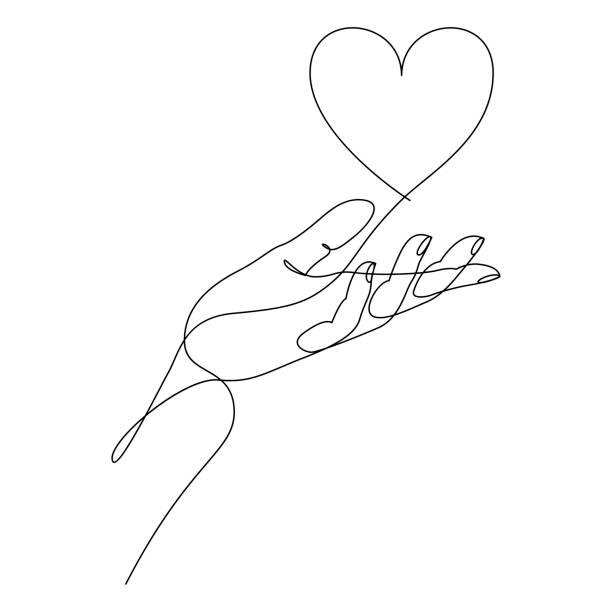Der Weg der Liebe kann beschrieben werden als eine Begegnung, die sich beständig zwischen den drei Polen leiblich exponierter Subjektivität vollzieht: Verwundbarkeit, Phantasma und Begehren. In der Liebe, die mit einer Erschütterung unseres habituellen Selbst- und Weltumganges und seiner stabilisierenden Sprach- und Zeitregister ihren Anfang nimmt, kartographieren wir unser Selbst und seine Welt neu. Doch nicht etwa in der erfüllenden Begegnung mit einem Anderen, der uns gleicht und uns ähnlich ist, sondern in der Begegnung mit dem Menschen, der eben genau dies – uns ähnlich, vertraut und nah − wiederholt und widerständig nicht ist. Liebe beginnt daher dort, wo wir uns dem Austausch mit dem Anderen am verwundbarsten Punkt unseres Selbst, nämlich am Ort unseres Strebens nach unbedingter Aufmerksamkeit und unverstellter Bedeutsamkeit rückhaltlos aussetzen und die Begegnung mit der Welt auch jenseits der Schutzwälle unserer Ich-Umgrenzung zulassen. Verwundbarkeit und das potenzielle Zulassen von Verletzungsmacht am Ort des Anderen, die uns am intimsten Punkt unseres Selbst trifft, gehören daher zu jeder Begegnung der Liebe mit dem Anderen konstitutiv hinzu.
Liebe ist und bleibt aber auch stets angewiesen und abhängig von einem Phantasma – einem kollektiven Code und einer gesellschaftlichen Praxis der Nähe, der Verschmelzung, der Bedeutsamkeitsstiftung und der Zugehörigkeit. Es ist das Phantasma der Liebe, das wir im Wunsch nach der Realisierung eines unerfüllbaren Begehrens zu ‚behausen‘ suchen, welches wir wiederholt gemeinsam durchschreiten und durcharbeiten und das wir gerade in den Ab-, Um- und Einbrüchen der liebenden Begegnung mit dem Anderen stets doch noch zu realisieren glauben. Es sind die phantasmatischen, unerfüllbaren und gerade in ihrer fiktiv-imaginären Dimension überaus wirkungsvollen, weil Wirklichkeit stiftenden und Realität erschaffenden Bilder der Liebe, die uns hier umfangen. Sie treten uns entgegen in Gestalt von Eigenschaften der Welt wie Beheimatung, Geborgenheit, Vertrautheit und Resonanz, die uns die Liebe zuteilwerden lassen soll und die wir in der Vereinigung mit dem Anderen zu finden und zu genießen hoffen. Doch das strukturbildende Phantasma der Liebe umfängt das Subjekt in seinen konstitutiven Brechungen niemals ganz. Der dauerhafte Besitz der Liebe und ihre bergende Schutzmacht gegen die Unbotmäßigkeiten der Welt sind daher stets phantasmatischer Natur und erweisen sich als eine ebenso fragile wie auf ihr eigenes Ende hin angelegte, imaginäre Konstruktion.
Der nicht hintergehbare Grundmodus der Realität der Liebe und ihres Begehrens nach Sinn und Bedeutsamkeit ist daher die konstitutive Verkennung seiner selbst und des Anderen. Liebe ist daher und beginnt dort stets von Neuem, wo ‚mehr‘ entsteht als das Phantasma der Nähe und Geborgenheit, welches uns wiederholt dazu verführt, auf die scheinbare Sicherheit zu setzen, dass Sich-Zeigen und Gefundenwerden in der Liebe zu einer eigenen Bedeutsamkeit finden werden. Und Liebe setzt sich fort in genau jenem Augenblick, in dem wir beginnen, den Zirkel der phantasmatischen Überformung unseres Begehrens und seiner Brechungen erneut zu durchschreiten.
Durch die Liebe sind wir dazu gezwungen, unsere je individuelle Verletzlichkeit zu riskieren und in Richtung auf die Erschaffung einer ‚besseren‘ Welt zu mobilisieren. Liebe stiftet in diesem Sinne eine neue Welt, die es vorher so nicht gab und die es ohne die Begegnungen der Liebe niemals gegeben hätte. Sie produziert und imaginiert Realität allerdings stets und bleibend im Modus der konstitutiven Verkennung. Und dennoch wäre ohne Liebe diese Welt nicht, wie sie ist, und ist mit der Liebe diese Welt so, wie sie ist, kein Deut weniger realistisch begriffen als ohne sie. Denn Welt und Wirklichkeit sind für den Menschen stets und überhaupt nur als Produkte einer imaginären Verkennung seiner selbst und des Anderen zugänglich. Das Potenzial der in der Liebe sich konstituierenden Realität dieser Verkennung besteht jedoch darin, dass sie als liebende Begegnung des Anderen noch am intimsten und schlechthin unvertretbaren Ort meiner selbst, nämlich mir leibhaftig widerfährt, und darin eine ungleich radikalere Transformation meiner selbst ist.