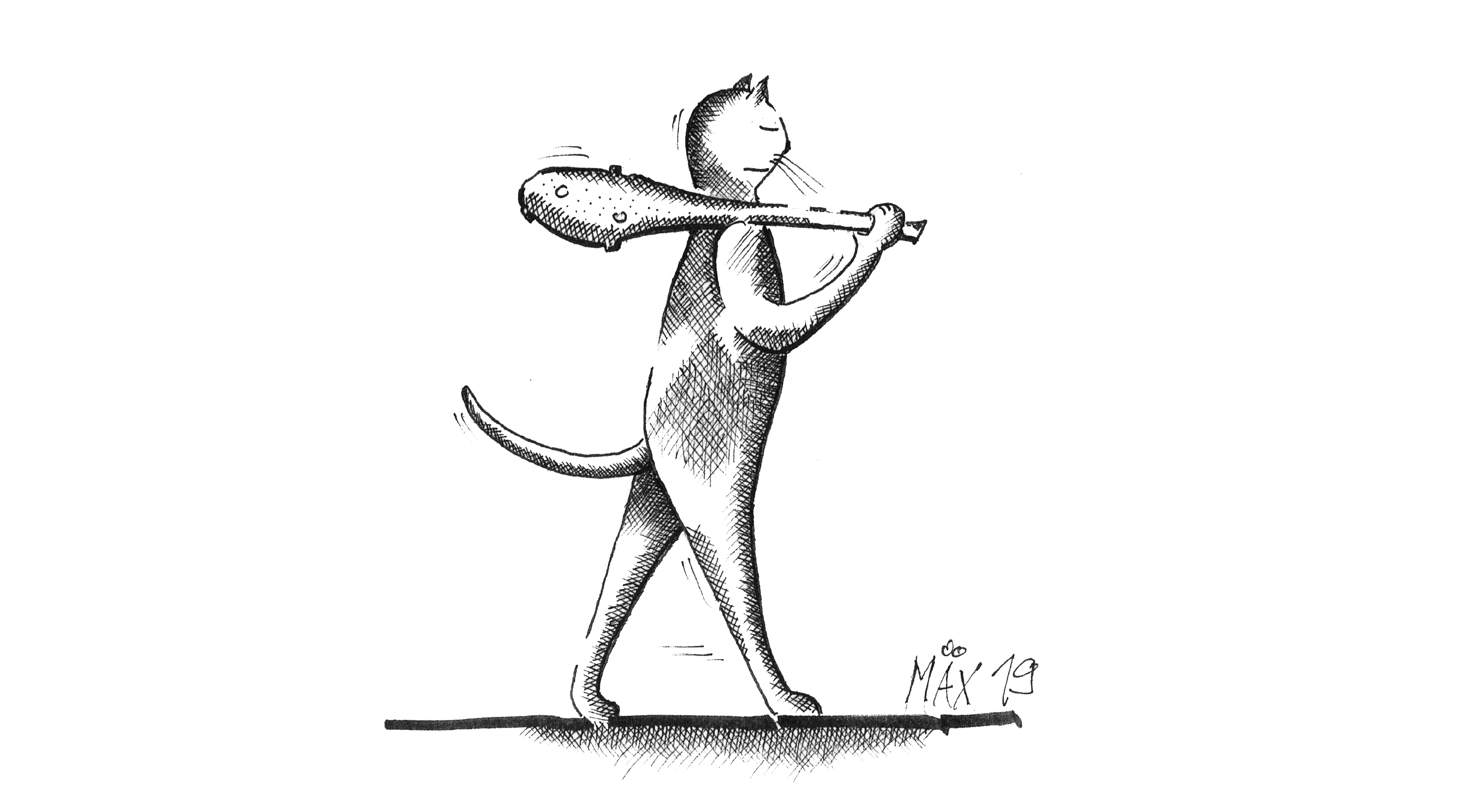(Text von Carlos Fraenkel)
Die grosse Kluft zwischen den moralischen, religiösen und philosophischen Auffassungen von Menschen ist keine Privatsache. Wir müssen unsere eigene geistig-kulturelle Heimat ernst nehmen und lernen, darüber zu streiten.
Sind wir nicht längst im Zeitalter der Globalisierung angekommen? Sind nationale und kulturelle Grenzen nicht obsolet? Sollten wir nicht lokaler Engstirnigkeit entfliehen und unvoreingenommene Weltbürger werden? Ich selbst war immer skeptisch, wenn es um das modische Weltbürgertum ging. Ich bin zwar ohne Heimat aufgewachsen, habe aber immer nach einer gesucht. Sie fehlt mir noch heute. Aus ganz anderen Gründen stellen Brexit, Trump, der wiedererstarkende Nationalismus in Europa und ähnliche Entwicklungen aus letzter Zeit diese Gewissheiten plötzlich in Frage. Das ist ein grosses Thema. Hier will ich nur auf einen Aspekt eingehen: Immigranten, die ein Stück Fremdheit aus ihrer Heimat mitbringen und von vielen Ansässigen als Bedrohung ihrer kulturellen Identität empfunden werden. Ich denke, wir sollten diese Reaktion ernst nehmen. Anhänger des Multikulturalismus machen es sich zu einfach, wenn sie behaupten, alle Kulturen seien gleich gut und deshalb dürfe man der eigenen keinen Vorrang einräumen. Aber ich bin ebenso gegen den Vorschlag, Fremden eine «Leitkultur» aufzuzwingen. Stattdessen plädiere ich dafür, unsere moralischen, religiösen und philosophischen Differenzen fruchtbar zu machen für das, was ich eine «Kultur des Streits» nenne: intellektuelle Räume, in denen wir lernen, die Dinge zu diskutieren, die uns am Herzen liegen, über die wir uns aber nicht einigen können.
In den letzten Jahren habe ich auf der ganzen Welt Philosophie-Workshops abgehalten – mit palästinensischen und indonesischen Studenten, mit chassidischen Juden in New York, brasilianischen Jugendlichen und Irokesen in Kanada. Wir haben untersucht, ob die Philosophie helfen kann, kontroverse Fragen klarer zu formulieren, und Antworten auf sie zu überprüfen: Existiert Gott? Was nützt Religion? Kann Gewalt gerechtfertigt werden? Was ist soziale Gerechtigkeit? Wie sollen wir mit dem Erbe des Kolonialismus umgehen? In den Diskussionen prallten oft unterschiedliche Standpunkte aufeinander. Ich behaupte, das sei gut, solange die Konflikte nicht in Gewalt umschlagen, sondern eben in eine Streitkultur münden. Multikulturelle Gesellschaften erlauben es, eine solche Streitkultur auch «zuhause» zu pflegen.
Zur eigenen geistig-kulturellen Heimat stehen
Ich bin gegen Gewalt – ob von muslimischen Fundamentalisten, die in Paris ein Blutbad anrichten, oder von christlichen Fundamentalisten, die vor beinahe drei Jahrzehnten, ebenfalls in Paris, Kinos anzündeten, in denen Martin Scorseses Film Die letzte Versuchung Christi gezeigt wurde. Aber auch wenn nur eine radikale Minderheit zu Gewalt greift, bleiben natürlich reale Differenzen. Wenn wir uns die Welt in einem globalen Gespräch vorstellen, gäbe es viele strittige Themen. Wir würden über Gott diskutieren und den Ursprung der Welt, darüber, wie ein gelungenes Leben aussieht und ob es ein Jenseits gibt, wir würden uns über das Verhältnis zwischen Männern und Frauen und über Kindererziehung auseinandersetzen, darüber, was gute Politik ausmacht, wie das Verhältnis von Staat und Religion aussehen sollte und vieles mehr. Immigranten bringen die Möglichkeit eines solchen Gesprächs direkt vor unsere Haustür.
Manchmal kommen Differenzen zufällig zum Vorschein. In dem Viertel in Montreal, in dem ich lebe, befindet sich etwa eine Jeschiwa (Talmudschule) gegenüber einem Sportstudio. Vor einigen Jahren forderten die Rabbiner die Leitung des Studios auf, die Fenster der Übungsräume zu verhängen, weil sie Sorge hatten, der Anblick knapp bekleideter Frauen und Männer beim Training werde die Talmudschüler ablenken. Die säkularen Nutzer des Sportstudios waren empört: Wie kommen diese frommen Juden dazu, uns ihre Moralvorstellungen aufzuzwingen? Der Konflikt offenbarte die grosse Kluft zwischen den moralischen, religiösen und philosophischen Auffassungen von Menschen, die in Montreal in ein und derselben Strasse wohnen.
Liberale Gesellschaften im Westen sind, was auf den ersten Blick paradox anmutet, kein fruchtbarer Nährboden für seriöse Debatten. Befürworter der strikten Trennung von Staat und Religion, etwa in Frankreich, bezeichnen unsere umstrittenen moralischen, religiösen und philosophischen Überzeugungen als Privatsache. In der Öffentlichkeit sei man schlicht citoyen, also Bürger, und nur zu Hause Jude, Christ oder Muslim. Anhänger des Multikulturalismus rufen uns dagegen dazu auf, Differenzen nicht bloss zu tolerieren, sondern zu feiern, als wären sie nicht auch Mitursache von Konflikten, sondern etwas Positives – ein Beitrag zum multikulturellen «Mosaik». Gemeinsam ist den Befürwortern der Trennung von Staat und Religion und dem Multikulturalismus, dass sie die Gründe des Anstosses, den wir an Überzeugungen und Werten von Andersdenkenden nehmen, nicht gelten lassen wollen – entweder will man sie aus der Öffentlichkeit verbannen, oder man will sie uns komplett ausreden.
In gewisser Hinsicht ist kulturelle Vielfalt natürlich eine Bereicherung. Wir können indisch oder chinesisch essen, Klezmermusik, Bossa Nova oder Jazz hören, uns in Yoga oder Tai Chi üben und so weiter. Trotzdem möchte ich nicht, dass meine Tochter in einer strenggläubigen Familie aufwächst (sei sie jüdisch, christlich oder muslimisch), auch nicht in einer säkularen Familie, deren Frauenbild sich in Barbiepuppen und Louis Vuitton-Handtaschen manifestiert. Wir nehmen uns nicht ernst, wenn wir behaupten, unsere Grundüberzeugungen seien genauso richtig wie diejenigen von Leuten, mit denen wir überhaupt nicht einverstanden sind. Mit anderen Worten: wir nehmen uns nicht ernst, wenn wir nicht zu unserer geistig-kulturellen Heimat stehen (die muss natürlich nicht mit traditionellen nationalen, religiösen und kulturellen Grenzen zusammenfallen; aber auch ein Marxist oder ein Weltbürger hat eine geistige Heimat und eckt mit Andersdenken an).
Meinungsverschiedenheiten in eine Kultur des Streits verwandeln
Eine Kultur des Streits ist ein Mittelweg zwischen Krieg und Frieden: Wir dürfen Menschen, deren Ansichten wir ablehnen, nicht über den Haufen schiessen, aber wir sollten sie entschieden kritisieren. Was bringt uns das? Wie schon gesagt, wir nehmen uns nicht ernst, wenn wir nicht überzeugt sind, dass wir im Recht sind und diejenigen, deren Ansichten wir nicht teilen, im Unrecht. Überzeugt zu sein, dass man Recht hat, heisst aber noch lange nicht, dass man tatsächlich im Recht ist. Nehmen wir nur die verwirrende Vielfalt von Überzeugungen und Werten, die im Laufe der Zeit in verschiedenen Kulturen vertreten wurden. Als ich vor einigen Jahren in Kairo mein Arabisch auffrischte, freundete ich mich mit ägyptischen Studenten an. Je besser wir uns kennenlernten, desto öfter sprachen wir über unsere Lebensentwürfe. Sie wollten mich zum Islam bekehren, damit ich nicht für alle Zeiten in der Hölle schmoren müsse. Ich dagegen wollte ihnen meine säkulare Denkweise nahebringen, damit sie ihr Leben nicht für ein illusionäres Jenseits opferten. «Kann die Existenz Gottes bewiesen werden?», war eine der Fragen, über die wir diskutierten. Ich war überrascht, denn in den Kreisen, in denen ich mich normalerweise bewege, wird diese Frage nie gestellt. Ich verneinte, doch meine ägyptischen Freunde kamen mit einem Beweis. Ich machte sie auf einen Denkfehler aufmerksam, woraufhin sie eine verbesserte Version vorschlugen. Die Diskussion endete ergebnislos.
Ich bin nicht zum Islam übergetreten und meine ägyptischen Freunde sind keine Atheisten geworden. Aber mir wurde klar, dass ich einige meiner Grundüberzeugungen nicht sorgfältig durchdacht hatte – von meinem Atheismus bis hin zu meinen Vorstellungen von einem gelungenen Leben. Wenn wir also nicht sicher sein können, dass wir Recht haben, auch wenn wir glauben, im Recht zu sein – sollten wir dann nicht jede Gelegenheit ergreifen, in Diskussionen mit Andersdenkenden unsere Auffassungen zu überprüfen? Oft sind diese Auffassungen ein Zufallsprodukt unserer Biographie: Eltern, Lehrer und viele andere Einflüsse prägen uns – von Medien, Mode und Werbung bis hin zu politischer Rhetorik und religiöser Ideologie. Debatten über kulturelle und religiöse Grenzen hinweg können die Rolle der sokratischen Schmeissfliege spielen: Menschen, die unsere Überzeugungen nicht teilen, zwingen uns, diese zu begründen – so wie ich dies in den Gesprächen mit meinen ägyptischen Freunden tun musste. Das ist sicherlich nicht der einzige Grund, warum wir Fremde in unserer Heimat willkommen heissen sollten. Aber es ist ein guter Grund.
Natürlich können Differenzen allein keine Kultur des Streits hervorbringen – sonst wären der Nahe Osten und der Balkan philosophische Debattierklubs. Oft genug entsteht Frustration, wenn nicht gar Gewalt. Deshalb lege ich so viel Wert auf das Wort «Kultur». Dafür ist zweierlei erforderlich. Erstens Debattiertechniken, die es uns ermöglichen, unsere Ansichten zu klären, Argumente zu entwickeln und auf die von Andersdenkenden einzugehen. Und zweitens Tugenden des Debattierens, vor allem das Bemühen um Wahrheit und nicht darum, als Sieger aus dem Streit hervorzugehen. Diese Werkzeuge und Tugenden könnten zum Beispiel in der Oberstufe von Sekundarschulen vermittelt werden.
Wenn es gelingt, unsere Meinungsverschiedenheiten in eine Kultur des Streits zu verwandeln, stellen sie keine Gefahr mehr für den sozialen Frieden dar. Natürlich kann es nicht darum gehen, im Supermarkt Meinungsgefechte über die Existenz Gottes oder über das richtige Leben zu führen. Statt aber unsere Differenzen unter den Teppich zu kehren oder zu verklären, sollten wir intellektuelle Räume schaffen, in denen Uneinigkeit produktiv werden kann – gerade jetzt, da Millionen von Flüchtlingen aus anderen Kulturkreisen auf Einlass in Europa hoffen.